Archive for the ‘Biedermeier’ Category
Dornenstück 0019: Pulvis et umbra sumus
Update zu Frankonachten 5/5: Du bist schon lange gestorben,
Dornenstück 0010: Antisterntaler
und Filetstück 0007: Kindergeschrei ist auch ein Gesangbuchvers:
Ich empfehle einmal mehr Raabe. Wobei ich zugeben muss, dass „Fabian und Sebastian„, das ich bisher nicht kannte, etwas für Hartgesottene ist. Die handwerkliche Raffinesse ist auf der Raabe überhaupt möglichen Höhe, den Ton aber – jammerig, verschwurbelt – muss man mögen, dann wird man froh, dann ist alles gut. Die Mixtur aus süßlichem Sozialrealismus, Poetischem Realismus, Erlösungskitsch und Exotismus, aus Gerede mit absichtsvoller Handlungsverdunkelung, ist schon speziell. Raabe schafft es, einen in die Langsamkeit des close reading zu zwingen, obwohl erst einmal nur gelabert und geunkt wird. Ich musste an Faulkner denken oder sogar an William Gaddis – Autoren, die ganze Bücher aus O-Tönen aufbauen. Fontane schüttelte sich zwischen Bewunderung und Grausen: „Ganz Raabe; glänzend und geschmacklos, tief und öde.“
Gustav Seibt, 23. Dezember 2023.
Man kann aber auch anteilnehmend bis leise gruselnd dem schrittweisen Ausbruch einer Altersdepression auf keinen zwei Druckseiten folgen.

——— Wilhelm Raabe:
Fabian und Sebastian
Westermanns Monatshefte, Braunschweig 1881, 10. Kapitel, Schluss:
Wahrlich, es ist so! Nicht immer fällt Einem die Wahrheit wie ein Stein auf das Herz und zermalmt es. Das Gewöhnlichste ist, daß sie niederrieselt wie Sand, anfangs kaum beachtet in den fliegenden Atomen, aber Körnchen auf Körnchen durch Tag und Nacht, – belächelt – dem Anschein nach durch einen Hauch weggeblasen, nicht des Nachdenkens und noch weniger eines körperlichen Mißbehagens werth. Wie genau muß der Mensch aufpassen, um zu merken, wie die Dämmerung kommt, wie aus der Helle die Dunkelheit wird! … Es ist da immer ein betroffenes, plötzliches Aufsehen und Aufmerken! Liegt es nicht wie ein leichter Staub auf den Dingen dieser Welt? Wo kommt der her? Was ist das? hat das wirklich etwas zu thun mit dem, was du eben noch vertriebest, indem du mit der Hand vor den Augen und der Stirn durchführest?! … Nun fährst du schon mit dem Finger über die dir nächsten Sachen in deiner Welt, und sieh, es giebt eine Spur, welche der Hogarth’schen Schönheitslinie gleicht, aber wie ein Fragezeichen aussehen würde, wenn du einen Punkt darunter machtest. Das thust du nicht; — du ärgerst dich und suchst um dich her nach einem, den du für dein vorübergehend Unbehagen die Schuld tragen lassen kannst. Vorübergehend? … Was ist das? Fängt nicht jeder Athemzug an, es dich selber merken zu lassen, daß die Veränderung, welche du in dir und um dich spürst, nicht vorübergehend und nicht einem Anderen zuzuschreiben sei?! … Wie grau die Welt wird! Staub über deinem Leben! Staub auf deinem Geiste!… Machtlos gegen den rieselnden Sand; – wehe dir, du fängst an nachzugrübeln über die Stunde, in der du zum ersten Mal Erde auf deiner Zunge schmecktest! Vielleicht an dem schönsten Frühlingsmorgen, in aller Blütenpracht, in dem lichterhelltesten Festsaale, unter allen lieblichsten und größesten Bildern und Tönen der Kunst war es; und eine schlimme Erschöpfung, eine öde Muthlosigkeit überwältigen dich. Gestern noch suchtest du nach einem, dem du die Schuld an deinem Verdruß geben konntest, und heute weißt du, daß du selbst dich verrechnetest, daß der Staub, der graue, trostlose Überzug auf deinen Lieblingsneigungen, deinen Anschauungen und Begriffen wachsen, immer wachsen wird; daß der Schatten und der Staub von Rechts wegen deine Herren sind auf deinem ferneren Lebenswege. Du hattest eine helle, laute Stimme und ein herzhaft, blechern, jovial Lachen, und nun wagst du nicht einmal mehr, laut zu sprechen; der ewig niederrieselnde Sand, der Staub auf den Dingen und Farben verschlingt auch den Ton in deiner Kehle. Du fühlst und findest dich in einer grauen Wüste allein – zähle doch die Sandkörner! rechne, rechne – aber rückwärts! Du rechnest mit dem Staube, der sich auf deiner Welt gesammelt hat und den kein Hauch der Luft irgendeiner Stunde wieder von den Dingen bläst; — ja wohl, die Zeit ist da, in welcher auch die gleichgültigsten guten Bekannten anfangen, sich zu verwundern und einander beiläufig zu fragen, an der Börse, an einer Straßenecke, nachdem du eben Abschied von ihnen genommen hast, an der Tafel, nachdem du eben die Serviette niederwarfest und den Rücken wendetest – immer wenn du den Rücken wendest:
„Finden Sie nicht auch, daß eine eigenthümliche Veränderung mit dem Manne vorgegangen ist? Finden Sie nicht auch, daß er über Nacht merkwürdig alt wurde? … Lassen Sie uns doch einmal rechnen, so hoch in den Jahren kann er eigentlich doch noch nicht sein. Sind wir nicht Zeitgenossen? Und über seinen Magen hat er doch auch nie geklagt. Was seine äußeren Umstände anbetrifft, so gäbe es nicht wenige, die gern mit ihm tauschen würden. Sonderbar, sehr sonderbar! Was meint denn Baumsteiger eigentlich dazu? … Nichts! Sie kennen ja die Herren Doktoren, lieber Freund, sie zucken die Achseln und sagen: Abwarten.“
Wir sagen:
Es ist ein anderes, ruhig und ergeben zu wissen: Pulvis et umbra sumus, Staub und Schatten sind wir; und ein anderes, mitten im Tumult und Genuß bei vollständigen Leib, und Seelenkräften zu merken: Staub und Nacht sind über dir und um dich, rieselnder Sand und Dunkelheit werden dich begraben!
Nachher fügen wir hinzu:
Es ist zwar wieder nur eine kleine Geschichte, die wir erzählen, und sie handelt durchaus nicht von großen Menschen und gewaltigen Zuständen, aber zu merken ist doch auch allerlei in ihr und aus ihr.

Bilder:
- The old man’s chaplet, aus: The Century, 1874;
- Ninety – and not found out, aus: Punch, 1922;
- Old Man Depression, aus: The Film Daily, 1930.
There is a crack in everything / That’s how the light gets in: Anthem, aus: The Future, 1992:
Dornenstücke 0016 und 0017: Dann lächelt der Vampyr, dann fahr‘ zurück und senke tief, o tief in dich den Blick (O Israel, wo ist dein Stolz geblieben?)
Update zu 2. Stattvent: Rorate coeli desuper! (Die Welt, ein weites Grab)
und Sonntag 7 von 7: Wo bleibt der Tröster?:

Den vierten Advent und den Heiligen Abend am selben Tag gibt es ungefähr alle sieben Jahre. Das ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, dass jemandes Geburtstag — oder sonst jeder andere Kalendertag auch — auf einen Sonntag fällt, ins schwer Berechenbare verschoben durch die Schaltjahre. Der Zusammenfall geschah zuletzt 1978, 1989, 1995, 2000, 2006, 2017 und 2023, nächstmals geschieht es 2028. Der Vorteil davon ist: Wenn der Advent nur drei Wochen dauert, darf man moralisch den Stollen dichter gedrängt wegfuttern.
Und wir dürfen gleich zwei Gedichte aus dem notorisch unterschätzten Geistlichen Jahr der Freiin Droste sinnhaft verschüren.

——— Annette von Droste-Hülshoff:
aus: Das geistliche Jahr : nebst einem Anhang religiöser Gedichte, 1820/1851:
Am vierten Sonntage im Advent
Ev.: Vom Zeugnisse Johannes.
Sie fragten: „Wer bist du?“ – und er bekannte und
leugnete nicht: „Ich bin eine Stimme des Rufenden
in der Wüste. – Ich taufe euch mit Wasser, aber er
steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt.“
Fragst du mich, wer ich bin? Ich berg‘ es nicht:
Ein Wesen bin ich sonder Farb‘ und Licht.
Schau mich nicht an; dann wendet sich dein Sinn;
Doch höre, höre, höre! denn ich bin
Des Rufers in der Wüste Stimme.In Nächten voller Pein kam mir das Wort
Von ihm, der Balsam sät an Sumpfes Bord,
Im Skorpion der Heilung Öl gelegt,
Dem auch der wilde Dorn die Rose trägt,
Der tote Stamm entzündet sein Geglimme.So senke deine Augen und vernimm
Von seinem Herold deines Herren Grimm,
Und seine Gnade sei dir auch bekannt,
Der Wunde Heil, so wie der schwarze Brand,
Wenn seiner Adern Bluten hemmt der Schlimme.Merk auf! Ich weiß es, daß in härtster Brust
Doch schlummert das Gewissen unbewußt;
Merk auf, wenn es erwacht; und seinen Schrei
Ersticke nicht, wie Mutter sonder Treu‘
Des Bastards Wimmern und sein matt Gekrümme!Ich weiß es auch, daß in der ganzen Welt
Dem Teufel die Altäre sind gestellt,
Daß Mancher kniet demütig nicht gebeugt;
Und überm Sumpfe engelgleich und leicht
Der weiße Lotos wie ein Kindlein schwimme.Es tobt des tollen Strudels Ungestüm,
Und zitternd fliehen wir das Ungetüm;
Still liegt der Sumpf und lauert wie ein Dieb:
Wir pflücken Blumen, und es ist uns lieb
Zu schaun des Irrlichts tanzendes Geflimme.Drum nicht vor dem Verruchten sei gewarnt;
Doch wenn dich süßer Unschuld Schein umgarnt,
Dann lächelt der Vampyr, dann fahr‘ zurück
Und senke tief, o tief in dich den Blick,
Ob leise quellend die Verwesung klimme!Ja, wo dein Aug‘ sich schaudernd wenden mag,
Da bist du sicher mindestens diesen Tag;
Doch gift’ger öfters ist ein Druck der Hand,
Die weiche Träne und der stille Brand,
Den Lorbeer treibend aus Vulkanes Grimme.Ich bin ein Hauch nur; achtet nicht wie Tand
Mein schwaches Wehn, um dess, der mich gesandt.
Erwacht, erwacht! Ihr steht in seinem Reich;
Denn sehet, er ist mitten unter euch,
Den ihr verkennt, und ich bin seine Stimme!

Am Weihnachtstage
Durch alle Straßen wälzt sich das Getümmel,
Maultier, Kamele, Treiber: welch Gebimmel!
Als wolle wieder in die Steppe ziehn
Der Same Jakobs, und Judäas Himmel
Ein Saphirscheinen über dem Gewimmel
Läßt blendend seine Funkenströme sprühn.Verschleiert‘ Frauen durch die Gassen schreiten,
Mühselig vom beladnen Tiere gleiten
Bejahrte Mütterchen; allüberall
Geschrei und Treiben, wie vor Jehus Wagen.
Läßt wieder Jezabel ihr Antlitz ragen
Aus jener Säulen luftigem Portal?’s ist Rom, die üppge Priesterin der Götzen,
Die glänzendste und grausamste der Metzen,
Die ihre Sklaven zählt zu dieser Zeit.
Mit einem Griffel, noch von Blute träufend,
Gräbt sie in Tafeln, Zahl auf Zahlen häufend,
Der Buhlen Namen, so ihr Schwert gefreit.O Israel, wo ist dein Stolz geblieben?
Hast du die Hände blutig nicht gerieben,
Und deine Träne, war sie siedend Blut?
Nein, als zum Marktplatz deine Scharen wallen,
Verkaufend, feilschend unter Tempels Hallen;
Mit ihrem Gott zerronnen ist ihr Mut!Zum trüben Irrwisch ward die Feuersäule,
Der grüne Aaronsstab zum Henkerbeile,
Und grausig übersteint das tote Wort
Liegt, eine Mumie, im heil’gen Buche,
Drin sucht der Pharisäer nach dem Fluche,
Ihn donnernd über Freund und Fremdling fort.So, Israel, bist du gereift zum Schnitte,
Wie reift die Distel in der Saaten Mitte;
Und wie du stehst in deinem grimmen Haß
Genüber der geschminkt und hohlen Buhle,
Seid gleich ihr vor gerechtem Richterstuhle,
Von Blute sie und du von Geifer naß.O tauet, Himmel, tauet den Gerechten!
Ihr Wolken, regnet ihn, den wahr und echten
Messias, den Judäa nicht erharrt!
Den Heiligen und Milden und Gerechten,
Den Friedenskönig unter Hassesknechten,
Gekommen zu erwärmen, was erstarrt!Still ist die Nacht; in seinem Zelt geborgen
Der Schriftgelehrte späht mit finstren Sorgen,
Wann Judas mächtiger Tyrann erscheint.
Den Vorhang lüftet er, nachstarrend lange
Dem Stern, der gleitet über Äthers Wange,
Wie Freudenzähre, die der Himmel weint.Und fern vom Zelte über einem Stalle,
Da ist’s, als ob aufs niedre Dach er falle;
In tausend Radien sein Licht er gießt.
Ein Meteor, so dachte der Gelehrte,
Als langsam er zu seinen Büchern kehrte.
O weißt du, wen das niedre Dach umschließt?In einer Krippe ruht ein neugeboren
Und schlummernd Kindlein; wie im Traum verloren
Die Mutter kniet, Weib und Jungfrau doch.
Ein ernster, schlichter Mann rückt tief erschüttert
Das Lager ihnen; seine Rechte zittert
Dem Schleier nahe um den Mantel noch.Und an der Türe stehn geringe Leute,
Mühselge Hirten, doch die Ersten heute,
Und in den Lüften klingt es süß und lind,
Verlorne Töne von der Engel Liede:
Dem höchsten Ehr‘ und allen Menschen Friede,
Die eines guten Willens sind!

Bilder: Tři oříšky pro Popelku, 1973,
via Matías Ss, 30. Dezember 2022.

Soundtrack: Die schönste von allen bekannten Tausenden Versionen Stille Nacht ist zweifellos eine englische – Silent Night –, nämlich die von die von Tom Waits. Sie ist nie auf einer Original-CD von ihm erschienen, insofern eine Rarität, nur auf SOS United, 1989 – eine Stiftung von Tom Waits für die SOS-Kinderdörfer. Der teilhabende Kinderchor bleibt unbekannt, weil ungenannt.
Im Video: Correggio: Anbetung der Hirten, 1530 (Detail); Tintoretto, 1545 oder 1578; Gerrit van Honthorst, 1622 oder 1646.
Fruchtstück 0009: Die Sünde der Erfolggenügsamkeit oder der Fahrlässigkeit, die stets sagt: „Es ist so auch recht“
Update zu Die alte und neue Inertia (Warum hast du nichts gelernt?),
Nachtstück 0012: Wie es enden wird, vermag ein irdischer Verstand nicht zu ergründen,
Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen
und Wenn–dann (weiß ich auch nicht):
Der Fachkräftemangel macht sich besonders in Nischengewerken bemerkbar. 1857, mein ich jetzt. Zu beheben scheint er mit Arbeitsmoral, aber das sagt sich wieder so leicht. Das gar zu leichtfertig hingeworfene „Bassd scho“ will nämlich wohlverstanden sein.

——— Adalbert Stifter:
Der Nachsommer
1. Band, 4. Die Beherbergung, 1857:
„Und habt Ihr dieses Haus eigens zu dem Zwecke der Schreinerei erbaut?“ fragte ich weiter.
„Ja,“ antwortete er, „wir haben es eigens zu diesem Zwecke erbaut. Es ist aber viel später entstanden als das Wohnhaus. Da wir einmal so weit waren, die Sachen zu Hause machen zu lassen, so war der Schritt ein ganz leichter, uns eine eigene Werkstätte hiefür einzurichten. Der Bau dieses Hauses war aber bei weitem nicht das Schwerste, viel schwerer war es, die Menschen zu finden. Ich hatte mehrere Schreiner, und mußte sie entlassen. Ich lernte nach und nach selber, und da trat mir der Starrsinn, der Eigenwille und das Herkommen entgegen. Ich nahm endlich solche Leute, die nicht Schreiner waren und sich erst hier unterrichten sollten. Aber auch diese hatten wie die frühern eine Sünde, welche in arbeitenden Ständen und auch wohl in andern sehr häufig ist, die Sünde der Erfolggenügsamkeit oder der Fahrlässigkeit, die stets sagt: ‚Es ist so auch recht‘, und die jede weitere Vorsicht für unnötig erachtet. Es ist diese Sünde in den unbedeutendsten und wichtigsten Dingen des Lebens vorhanden, und sie ist mir in meinen früheren Jahren oft vorgekommen. Ich glaube, daß sie die größten Übel gestiftet hat. Manche Leben sind durch sie verloren gegangen, sehr viele andere, wenn sie auch nicht verloren waren, sind durch sie unglücklich oder unfruchtbar geworden, Werke, die sonst entstanden wären, hat sie vereitelt, und die Kunst, und was mit derselben zusammenhängt, wäre mit ihr gar nicht möglich. Nur ganz gute Menschen in einem Fache haben sie gar nicht, und aus denen werden die Künstler, Dichter, Gelehrten, Staatsmänner und die großen Feldherren. Aber ich komme von meiner Sache ab. In unserer Schreinerei machte sie bloß, daß wir zu nichts Wesentlichem gelangten. Endlich fand ich einen Mann, der nicht gleich aus der Arbeit ging, wenn ich ihn bekämpfte; aber innerlich mochte er recht oft erzürnt gewesen sein und über Eigensinn geklagt haben. Nach Bemühungen von beiden Seiten gelang es. Die Werke gewannen Einfluß, in denen das Genaue und Zweckmäßige angestrebt war, und sie wurden zur Richtschnur genommen. Die Einsicht in die Schönheit der Gestalten wuchs, und das Leichte und Feine wurde dem Schweren und Groben vorgezogen. Er las Gehilfen aus und erzog sie in seinem Sinne. Die Begabten fügten sich bald. Es wurde die Chemie und andere Naturwissenschaften hergenommen, und im Lesen schöner Bücher wurde das Innere des Gemütes zu bilden versucht.“
Bilder: John William Godward: When the Heart Is Young, 1902;
Dolce Far Niente II, 1904, via Psychoactivelectricity Redux, 10. Oktober 2023.Soundtrack: Natalie Merchant: House Carpenter, aus: The House Carpenter’s Daughter, 2003:
So ersann ein fremder Wand’rer, Nürnberg, dir dies schlichte Lied
Update zu Zwetschgenzeit (zu spät),
You’ll learn to sprechen Deutsch mein kind, ash fast ash you tesire,
Frankonachten 3/5: Und schuld dran war die Ofenhitz
und Die pelzige Squaw mit der Eisernen Jungfrau:
Ja, genau, es geht um den Longfellow, Henry Wadsworth, gegen den der noch größere Poe ab 1841 bis etwa 1845 einen recht einseitig geführten Longfellow War losbrach, wegen angeblichem Plagiarismus und mangelnder Originalität. Longfellow ließ sich’s nicht verdrießen, führte weiterhin sein luxuriös privatisierendes Leben und unterstützte nach Poes frühem Tod im Rinnstein sogar noch dessen Verwandte — nachdem er inmitten der ausbleibenden Kriegshandlungen 1842 mal in Nürnberg vorbeigeschaut hatte.
Eine Bronzetafel erinnert am Gebäude Karolinenstraße 43/45 an den Besuch des amerikanischen Schriftstellers Henry W. Longfellow in Nürnberg im Jahr 1842. […]
Nicht nur amerikanische Kinder, auch etliche ältere Franken erinnern sich, dass sie in ihrer Schulzeit Longfellows Gedicht „Nürnberg“ auswendig gelernt haben, berichtet Altstadtfreunde-Vorsitzende Inge Lauterbach. Die ausführlichen Verse erschienen in mehreren Ausgaben, manche waren sogar mit Goldschnitt und Kupferstichen verziert. Auch in der Nürnberger Stadtbibliothek befinden sich unter den 19 Titeln Longfellows sechs Ausgaben des Loblieds auf die Frankenmetropole.
Die Inspiration für diese Zeilen holte sich der an der Ostküste geborene Amerikaner bei seinem Europa-Besuch im Jahr 1842. Vom 23. bis zum 27. September logierte er im „Hotel zum Strauß“ in der heutigen Karolinenstraße 43/45 (gegenüber dem T-Punkt) und erkundete als kulturbeflissener Tourist die Stadt. […]
In einem Brief an seinen deutschen Dichterfreund Ferdinand Freiligrath schildert er, wie er mit einem Reisegefährten das einstige Wohnhaus des Schusters Hans Sachs besuchte, das sich damals bereits zur Kneipe gewandelt hatte: „Wir tranken einen Krug Bier im Gedenken an den Dichter, während wir uns aus einem Band seiner Werke … vorlasen“.
Schließlich trat Longfellow auch dem „Nürnberger Literarischen Verein“ bei, der später im Pegnesischen Blumenorden aufgegangen ist. Dort wird der Amerikaner immer noch als Mitglied Nr. 677 geführt.
Hartmut Voigt: Späte Erinnerung in Bronze an den Besuch 1842, Nordbayern 17. April 2008.
 Das Original von Longfellow: Nuremberg 1842 — „In the valley of the Pegnitz, where across broad meadow-lands / Rise the blue Franconian mountains, Nuremberg, the ancient, stands.“ pp. — ist gut dokumentiert. Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung von Wilhelm Steuerwald, das es auf vierzeilige Strophen aufteilt, benutzt es pro Strophe zwei Langzeilen — mit dem Vorteil, dass die Zeilen 1 und 3 nicht ungereimt bleiben müssen, und mit dem Nachteil, dass ich die beiden Versionen nicht parallel in eine Weblog-Spalte pressen kann, ohne das Layout heillos zu zerschießen.
Das Original von Longfellow: Nuremberg 1842 — „In the valley of the Pegnitz, where across broad meadow-lands / Rise the blue Franconian mountains, Nuremberg, the ancient, stands.“ pp. — ist gut dokumentiert. Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung von Wilhelm Steuerwald, das es auf vierzeilige Strophen aufteilt, benutzt es pro Strophe zwei Langzeilen — mit dem Vorteil, dass die Zeilen 1 und 3 nicht ungereimt bleiben müssen, und mit dem Nachteil, dass ich die beiden Versionen nicht parallel in eine Weblog-Spalte pressen kann, ohne das Layout heillos zu zerschießen.
Außerdem lehne ich mich soweit aus dem Fenster zu behaupten, dass die Übersetzung, die Das Nürnberg-Lesebuch von Steffen Radlmaier 1994 (und noch in der Neuausgabe 2010) benutzt, von jemandem erstellt wurde, der sich in Nürnberg nicht auskennt; zum Beispiel findet sich auf dem Nürnberger Hauptmarkt nur ein einziger Brunnen, sei er namensstiftend schön oder kreuzhässlich.
Dem Mainer Touristen Longfellow seien Ungenauigkeiten und ein leicht verrutschter Fokus auf das, was Nürnberg ausmacht, nachgesehen. Als ausgesprochenes Meisterwerk war das Stück wohl nicht einmal bei der Produktion gedacht, nur als wertschätzende Gedanken- und Fingerübung während des Sightseeings. Dass Schülergenerationen nach ihm seine Spielerei noch auswendig lernen sollten, wie die führende Nürnberger Altstadtfreundin Inge Lauterbach — siehe oben — hinterbringt, hätte Longfellow wahrscheinlich am meisten von allen Beteiligten gewundert.
Insgesamt liegt der Wert dieses touristischen Gelegenheitsstücks weniger darin, wunder wie genial es geschrieben ist, sondern von wem es geschrieben ist.
——— Henry Wadsworth Longfellow:
Nürnberg
1842, veröffentlicht als Nuremberg: A Poem, in: The Belfry of Bruges and other Poems, 1845,
dt. Übs.: Wilhelm Steuerwald, in: ders., Hrsg: Nürnberg im Lied, Leonhard Schrag, Nürnberg/Leipzig 1913, Seite 12 bis 15,
cit. nach: Steffen Radlmaier, Hrsg: Das Nürnberg-Lesebuch,
ars vivendi verlag, Cadolzburg 1994, Seite 98 bis 101:
In dem Pegnitztal in Franken,
Wo auf weite Wiesenau
Blaue Berge niederblicken,
Stehet Nürnberg altersgrau.
Stadt des Handels und der Arbeit,
Stadt des Sanges und der Kunst –
Um die spitzen Giebel flattern
Dohlengleich im fahlen DunstAlter Zeit Erinnerungen,
Da die Kaiser kühn und groß
Thronten auf dem felsenfesten,
Zeiterprobten Bergesschloß.Und in wundersamen Weisen
Rühmte deiner Bürger Sang,
Daß der Reichsstadt Hand und Wirken
Weit durch alle Zeiten drang.In des Burghofs Mitte stehet,
Eingeschient mit Eisenband,
Noch die Linde, die einst pflanzte
Kaiserin Kunigundes Hand.Den Sankt Sebald Pfarrhof zieret
Noch des Erkers Heiligtum,
Wo einst Dichter Melchior weilte
Singend Maximilians Ruhm. –Hier die Wunderwelt der Künste
Allerwärts das Aug entzückt:
Auf dem Marktplatz schöne Brunnen,
Reich mit Bildwerk ausgeschmückt;Vom Portal der Kathedralen
Heilige in Stein gehauen,
Gottesboten früh’rer Zeiten,
Mahnend auf uns niederschauen;In der Sankt Sebalduskirche
Ruh’n des Heiligen Gebeine
Unter’m Schutz der zwölf Apostel
Friedlich in dem Silberschreine;In der Kirche Sankt Laurentius
Ragt die heilige Monstranz
Gleich den Garben der Fontaine
Himmelwärts in hehrem Glanz.Hier auch lebte, wirkte, kämpfte
Albrecht Dürer fromm und wahr,
Heil’ger Kunst Apostel stellt‘ er
Seines Heilands Leben dar.Still ertragend seinen Kummer,
Schaffend stets mit ems’ger Hand,
Schaute er gleich einem Pilger
Aus nach jenem besser’n Land.Emigravit – hat als Inschrift
Man ihm auf sein Grab gegeben;
Tot nicht, nur geschieden ist er,
Denn ihm blühet ewig Leben.Und die alte Stadt scheint schöner
Schöner strahlt ihr Sonnenschein,
Weil ihr Pflaster er betreten,
Ihre Luft er saugte ein.
Durch die Straßen breit und stattlich,
Durch die Gassen schmal und eng
Tönten einst der Meistersinger
Liedesweisen herb und streng.Aus der fernen düstern Vorstadt
Kamen sie zur schmucken Gilde,
Daß am großen Ruhmestempel
Jeglicher ein Nest sich bilde.Seine Reime wob der Weber
Nach des Schiffchens Taktesschwingen
Und der Schmied ließ seine Maße
Auf dem Amboß laut erklingen.Dankend Gott, der große Weisheit
Auf der Schmiede staub’gen Fliesen,
Wie auch im Gebild des Webstuhls
Dichtungsblumen ließ ersprießen.Hier Hans Sachs der Schusterdichter,
Haupt der wackern Schar und Preis
Größter der Zwölf Weisen Meister,
Sang und lachte bändeweis.Doch sein Heim ist jetzt ein Bierhaus,
Säuberlich bestreut mit Sand
Ist die Schenke, und um’s Fenster
Blumen flocht der Liebe Hand.Überm Eingang zeigt ein Bild ihn
Mit dem langen weißen Bart,
Wie in Adam Puschmanns Versen,
Sanft und mild nach Taubenart.
Schaffensmüde kommt am Abend
Der gebräunte Handwerksmann,
Zecht im Stuhl des alten Meisters
Aus der blanken Zinnenkann.Alter Glanz ist hingeschwunden
Wogend und verworren steigen
Vor mir gleich verblaßtem Teppich
Bilder auf in buntem Reigen.Nicht Konzile und nicht Kaiser
Waren dir zum Weltruhm Führer,
Nein – Hans Sachs, der Schusterbarde,
Und der Maler Albrecht Dürer.So ersann ein fremder Wand’rer,
Der vom fernen Westen schied,
Auf dem Gang durch Straßen, Höfe,
Nürnberg, dir dies schlichte Lied;Sammelnd aus des Pflasters Ritzen
Eine bodenständ’ge Blum:
Harter Arbeit hohen Adel,
Heißen Mühens langen Ruhm.
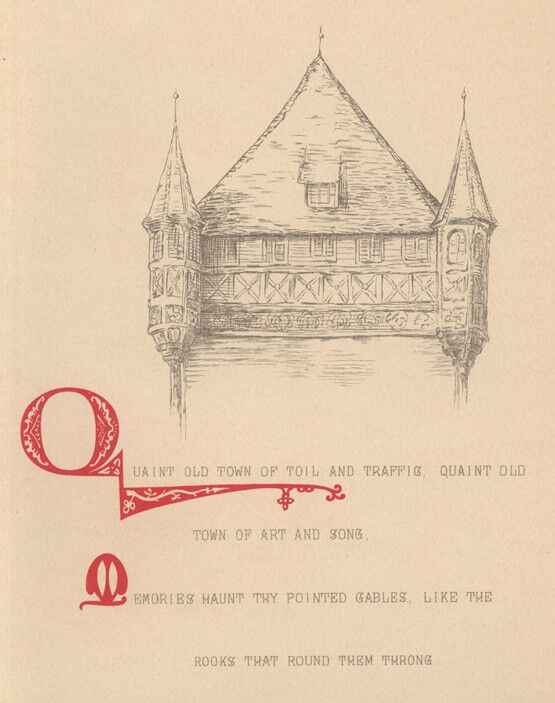
Bilder: Nuremberg by Henry W. Longfellow, Illustrated With Twenty-Eight Photogravures
by the Gebbie & Husson Co., Limited, Illuminated and Arranged by Mary E. and Amy Comegys,
Philadelphia 1888, via Maximun Service 845, 3. August 2023.
Soundtrack: Die Ode an die Freude in einer Flashmob-Version, die eher an den Song of Joy als an den vierten Satz einer Beethoven-Symphonie gemahnt, am 14. Juni 2014 auf dem Nürnberger Lorenzer Platz vor der gleichnamigen, von Longfellow kurz mitbesungenen Kirche. Ach, kommt schon – Mut zur Schnulze! –:
Doch Frauenliebe habt ihr nie genossen, an Frauenantheil habt ihr nie geglaubt (Man sollte meinen, daß es Dichtung wäre!)
Update zu Nachtstück 0020: Im rauschenden Wellenschaumkleide
(In dem düstern Poetenstübchen),
Gräflein Du bist verrathen
und Fruchtstück 0004: Der heil’ge Rhythmus in Verselein und Rimelein:
Von August Graf von Platen-Hallermünde ist nicht viel auf unsere Tage gekommen. Das leitet sich womöglich vom einflussreicheren Heinrich Heine her, der seinen zweitgrößten Literatenstreit nächst demjenigen mit Ludwig Börne mit dem Grafen Platen geführt hat. Heines Vorwürfe ergingen sich zum einen in dem, was heutzutage unter Kink-Shaming und Homophobie fiele, zum anderen darin, dass Platens Lyrik bis zur Leblosigkeit durchperfektioniert seien.
Ob ein Dichter schwul, objektophil oder mit sonst einer Vorliebe seiner Wahl gesegnet ist, interessiert heute allenfalls dokumentarisch; den zweiten Vorwurf muss man sich aber mal geben: Platen sei ein verächtlicher Dichter, weil er korrekte Metren verwendet. Und gerade dieser Einwand zieht sich bis in die jüngste Literaturforschung durch: Platens kompromisslose Perfektion wie aus der Schulpoetik erzeuge kein lyrisches Tanzen, sondern ein hölzernes Geklapper, das sich durch ganze Gedichtsammlungen zieht. Kann ja alles sein. Persönlich bewundere ich es heillos, wenn jemand seine lyrischen Formen beherrscht und man ihm seine Hebungen und Reimmuster nicht eigens nachzählen muss, weil man sich auf sein Handwerk verlassen kann.
Die verlegerische Pflege von Platens Werk ist spätestens im 20. Jahrhundert abgerissen, möglicherweise wegen Heines Verunglimpfungen, von denen sich sein Ruf nie wieder erholt hat, oder seinem anderen großen Kollegenstreit mit Karl Leberecht Immermann, der bei Platen gern „Nimmermann“ heißt und die Herabsetzungen ebenso wenig verdient wie Platen die seiner Gegenseiten. Seine Werksammlungen im 19. Jahrhundert umfassen mal zwei, mal fünf Bände, die historisch-kritische Ausgabe stammt von 1910. Danach war sein Gedicht Das Grab im Busento von 1820 noch eine Zeitlang Schulstoff.
1982 haben sich Artemis & Winkler noch einmal erbarmt und von Kurt Wölfel und Jürgen Link eine auf zwei Bände angelegte Gesamtausgabe herausgeben lassen, deren erster Band mit der Lyrik natürlich längst vergriffen ist und noch gelegentlich antiquarisch und dann überteuert auftaucht. Der zweite Band mit der Prosa und den Dramen ist gar nicht erst erschienen.
Der vorhandene erste Band Lyrik ist ein veritabler Tausendseiter mit dem Anspruch auf Vollständigkeit und wegen Platens inkriminierer Formenstrenge ein ungeordnetes, aber geradezu unerschöpfliches Kompendium lyrischer Formen; allein die Ghaselen nehmen 157 Seiten ein. Dankenswerter Weise haben die Herausgeber nach jeden thematischen Abschnitt einen weiteren „Aus Platens Werkstatt“ mit unveröffentlichtem Frühwerk und Ausschuss geordnet.
Trotzdem fehlt in all dieser Fülle sein Balladenfragment Der grundlose Brunnen, und ich hoffe nur inständig, dass ich da auf die einzige Fehlstelle weit und breit gestoßen bin und nicht auf ein Beispiel dafür, was da nicht noch alles unbegründet fehlen könnte.
Realistisch erreichbar ist dieses Stück aktuell nur in Frank T. Zumbach, Hrsg.: Das Balladenbuch. Deutsche Balladen von den Anfängen bis zur Gegenwart, ebenfalls bei Artemis & Winkler, Berlin 2016, Seite 268 bis 272. Wo Zumbach es seinerseits her hat, ist ihm auf Nachfrage inzwishen entfallen, er vermutet nur vage in seinem reichhaltigen Keller etwas Zweibändiges aus dem Neunzehnten, das er auch in seiner Balladensammlung nachweist, das wäre dann eine Werksammlung unsicherer Zuordnung von 1847. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es genau dort bei Zumbach dem professionellen Sprecher Jan Terstiege aufgefallen, der es 2019 für seine Sammlung Literatur zum Hören an einem Balladensonntag eingelesen hat. Fragmentarisch, wie es ist, dauert das zwölf Minuten. Bei Zumbach sind das fünf Druckseiten DIN A4. Ein Jammer, dass die Handlung schon abreißt, bevor sie Fahrt aufnimmt:
Der Graf von Platen entstammte einem schon zu seinen Lebzeiten verarmten Adelsgeschlecht und war Franke, aus der heutigen mittelfränkischen Hauptstadt Ansbach. Gestorben ist er 39-jährig im sizilianischen Syrakus an einer Überdosis von Medikamenten gegen eine Krankheit (Cholera), die er gar nicht hatte.

——— August Graf von Platen:
Der grundlose Brunnen
Eine fränkische Sage
Fragment, 1820,
cit. nach: Gesammelte Werke des Grafen August von Platen in fünf Bänden, Vierter Band,
J. G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Tübingen 1847, Seite 206 bis 213:
Die Sonnenfackel tauchte rosenfarben
Sich in die Berge fernhin und erblich,
Eine Schnitterhaufen führte heim die Garben,
Und sang und jubelt‘ und ergötzte sich;
Doch als die heitern Melodien erstarben,
Trat in den Burghof Herzog Udalrich,
Die Knappen aber grüßten ihn und schieden,
Denn er war gern allein und gern vermieden.Es quoll ein Bronnen in des Hofes Mitte,
Aus dem die röm’schen Männer schon getrunken,
Als hier sie wandelten im Siegerschritte,
Lang eh‘ man Burg und Kirche hier sah prunken,
Und eh‘ man betete nach Christensitte:
Schon war das Mauerwerk halb eingesunken,
Doch standen rings uralte Lindenbäume,
Die ihren Schatten warfen in die Schäume.Dort ließ nun traurig sich der Herzog nieder,
Und Seufzer hoben seinen Busen schwer,
Tief in die Welle schaut er hin und wieder,
Doch kein Genüge schaut und findet er;
Da kommt des Schlosses Vogt, getreu und bieder,
Der vielbejahrte Diener kommt daher,
Ob er den Herrn gelaunt zu Worten träfe,
Entblößt das Haubt er und die greise Schläfe.Schon lange sinn‘ ich, spricht er, was euch bange,
Erlauchter Herzog, was euch düster macht:
Wie habt ihr sonst beim Sonnenuntergange
Gescherzt mit Freunden und euch frohgelacht!
Und, wie’s geziemet euerm Fürstenrange,
Die schönen Tage ritterlich verbracht!
Wie scholl’s von Waffen und vom Jägerhorne!
Nun sitzt ihr ewig träumerisch am Borne.Verschwanden jene Bilder, die den Knaben,
Vom einst’gen Waffenruhm, von Kampf und Sieg,
Vom Habedank aus schöner Hand, umgaben?
Ihr wolltet ziehen in den heil’gen Krieg,
Zur Stätte, wo den Herren sie begraben,
Wo er gen Himmel durch den Aether stieg:
So träumend sonst von Fahrt und Abenteuer
Seid ihr gefesselt nun an dieß Gemäuer?Was staunst du, daß ich stets mich hier befinde,
Sobald die Stralen im Gebirg verglühten?
Aus dieser Quelle steigen kühle Winde,
Und wenn die Flut zu kräuseln sie sich mühten,
Dann ziehn sie säuselnd durch die laub’ge Linde,
Und wehn herunter den Geruch der Blüten,
Die Blüten selbst, sie fallen oft, betrogen,
Zu Sternen, die sich spiegeln in den Wogen.Laßt euch beschwören, Herr, bei eurem Ruhme,
Spricht Jener! trotzt dem Zauber, der euch band!
Der Bronnen stammt noch aus dem Heidenthume,
Und ward gegraben von Druidenhand:
Drum wird verzaubert jede Blüt‘ und Blume,
Die hier emporwächst an des Wassers Rand:
Hier ward noch nie ein frommes Werk begonnen,
Und Nixen hausen, wie man sagt, im Bronnen.Zwar ist das Wasser hier von großer Güte,
Doch ohne wahre, heiligende Kraft:
Denn als vordem, mit gläubigem Gemüte,
Der heil’ge Winfried, der so riesenhaft
Sich um dieß Land und um dieß Volk bemühte,
Von Sünden reinigte die Heidenschaft,
Da sah man nie mit dieser Flut ihn heilen,
So wird erzählt, noch je die Tauf‘ ertheilen.Auch sagen sie, und solches könnt ihr stündlich
Mit Senkblei selbst erproben oder Stange,
Daß diese Flut so völlig unergründlich,
Daß auf den Boden nie ein Stein gelange:
Drum hütet euch, versucht nicht keck und sündlich,
Ob mit der Hölle sie zusammenhange!
Der Alte rief’s, und zog ihn weg vom Orte,
Da sprach der Herzog diese sanften Worte:O wollte Gott, ich hätte nie vernommen,
Wie viele Seligkeiten wunderbar
Aus dieses Brunnens heil’ger Tiefe kommen,
Vielleicht bedünkte, was du sagst, mich wahr!
Als einst die Sterne schon am Himmel glommen,
Dem Geiste rätselhaft, dem Auge klar,
Trat ich hierher, mich freuend ihrer Helle
Dort oben und hier unten in der Welle.Da scholl ein Tönen, wie aus tiefer Vase,
Ausdrückend Sehnen halb und halb Vergnügen,
Ich lauschte hier bewegungslos im Grase,
Und zog den Ton in mich in vollen Zügen:
Mir schien’s als wären’s Lilien von Glase,
An die metallne Schmetterlinge schlügen,
So rein erscholl’s, so tief ergriff’s die Seele,
Ach, wohl kein Lied aus einer Menschenkehle!Doch war’s ein Lied, noch in mir klingt es rein,
Noch klingt es, doch es klingt zu meinem Schmerze.
Nun find‘ ich hier mich jeden Abend ein,
Daß ich kein zweites schönes Lied verscherze,
Doch, ach nicht zweimal sollt‘ ich glücklich sein,
Und unbefriedigt bleibt mein armes Herze,
Stets horchend auf die wundersam geheime,
Fremdart’ge Weise, die gelinden Reime.Es war, erwiedert ihm der Vogt, ein Traum:
Oft kann ein Traum der Seele Frieden stören,
Zum Schlafe lockt hier schattig Baum an Baum,
So mocht‘ euch wohl die Phantasie bethören,
Denn niemals ließen aus dem tiefen Raum
Sich menschenähnliche Gesänge hören,
Nur Käfer summen hier mit sachten Stimmen,
Die auf den Blättchen in der Quelle schwimmen.Doch wißt, woher euch dieser Wunsch entsprossen,
Der nun euch die gewohnte Ruhe raubt?
Ihr seid in frischer Jugend aufgeschossen,
Und dichte Locken fliegen euch um’s Haubt;
Doch Frauenliebe habt ihr nie genossen,
An Frauenantheil habt ihr nie geglaubt,
Nun regen sich, wenn auch noch halb verborgen,
In euch die kommenden, die lieben Sorgen.O hört mich an mit gütigem Vertrauen,
Wenn je mein wohlgemeinter Rat euch galt,
In diesen Thälern wächst, in diesen Auen
Wie manche jungfräuliche Wohlgestalt;
So laßt die Ritter, Herrn und Edelfrauen
Nach eurem Schlosse laden, jung und alt,
Schmückt einmal wieder eure Burg zum Feste,
Und kommen sie, so wählet euch die Beste.Der Herzog hört’s, zwar mit beklemmtem Herzen,
Doch seine Stirn entwölkte sich, die hohe,
Und sei’s ein Wechsel nur von Schmerz um Schmerzen,
Des Wechsels freu’n sich Traurige wie Frohe.
Das Fest erscheint, es flackern tausend Kerzen
Den Saal entlang in schöner goldner Lohe,
Und wie den Reigen schlingen zarte Hände,
Da wiederhallen von Musik die Wände.Der laute Ton von Zither, Flöt‘ und Horne
Durchscholl den Burghof, hallte durch’s Gestein,
Und drang hinab, wo tief im Silberborne
Die Meerfrau wohnte mit drei Töchterlein.
Der ältesten und lieblichsten, Hydorne,
Fuhr jeder Laut in’s tiefe Herz hinein,
Und leichtbereit ein kühnes Wort zu wagen,
Begann sie so der Mutter vorzuklagen:Das Bad ist kühlend hier im Wasserschwalle,
Viel goldne Fische tauchen in die Wogen,
Viel Edelsteine kleben an der Halle,
Die weit geräumig ist und hoch im Bogen
Gewölbt aus einem einzigen Krystalle,
Vom Lotosteppich lieblich überzogen,
Und ihr geheim und unterirdisch Dunkel
Erhellt durch einen magischen Karfunkel.Doch hast du, Mutter, uns nicht selbst berichtet,
Um wie viel schöner sich es lebt dort oben,
Das Licht, hier im Karfunkel nur verdichtet,
Ist dort in Stralen durch die Welt zerstoben,
Und wenn die Nacht der Sonne Kraft vernichtet,
So schmückt der Himmel sich mit goldnen Globen,
Der Mond mit ihnen, eine Silberfähre;
Man sollte meinen, daß es Dichtung wäre!Die Erde, sagt man, dehnt sich, und ihr dienen
Der Kräuter viel zu Stickerei’n und Zier,
Viel Rosen, gleich lebendigen Rubinen,
Und Thau dran, wie beweglicher Sapphir.
O hättest nimmer du erzählt von ihnen,
Sie duften, sagst du, dufteten sie mir!
Umgäbe mich ihr freundliches Gewimmel,
Und drüber hin der amethystne Himmel!O laß uns drum empor zum Borne steigend,
Ergötzen uns, nur bis die Nacht verschwunden,
Hydorne sprach’s, zwar nicht in Worten zeigend,
Daß jene Töne sie so sehr gebunden,
Doch nicht aus falschem Herzen es verschweigend,
Von Scham vielleicht im Stillen überwunden,
Von einer Scham, die sie sich nicht erklärte.
Die Mutter sprach zur Tochter, und gewährte:Geh mit den Schwestern nur hinauf, Hydorne,
Freut euch der Sternchen und des Mondenkahnes,
Der Blumen auf den Wiesen und im Korne,
Und all des überird’schen Menschenwahnes,
Doch reizt die Nixenfürstin nicht zum Zorne,
Und eilt zurück beim ersten Ruf des Hahnes,
Daß nicht ein Sonnenstral euch etwa leuchte,
Bevor ihr kehrt in’s unterirdisch Feuchte.Indessen strömten durch die Burggemächer
Der Gäste viel, und alles regte sich,
Es jubelten die Tänzer und die Zecher,
Solang man Flöte blies und Geige strich;
Doch auch nicht einmal hob den goldnen Becher
Noch flog im Tanze Herzog Udalrich,
Noch blickt er jemals nach den Mädchen allen
Mit einer Miene nur von Wohlgefallen.Da wandeln plötzlich durch die muntern Schaaren
Drei holde Jungfrau’n, doch wie Lilien bleich,
Sie hatten feine Schleier in den Haaren,
Die bis zur Erde hingen faltenreich
Und von durchsichtigem Gewebe waren,
Der Spinne zarten Silberstoffen gleich.
Ihr Gürtel wob sich aus korallnen Bändern,
Doch feucht erschien der Saum an den Gewändern.

Bilder: Jean-Léon Gérôme: La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l’humanité, 1896;
Édouard Debat-Ponsan: La Vérité sortant du Puits, 1898.
Soundtrack: Am Brunnen vor dem Tore, aus: Die Trapp-Familie, 1956:
Fruchtstück 0008: Roth ist ja dein ganzer Mund, er macht deinen Fehler kund
Update zu Fruchtstück 0002: Ein Schooß voll den begehr ich nicht,
Liebchen öffne deinen Schoos,
Denn meine Jungferschafft ist pflücke (ein Mädchen macht sich nichts daraus)
und Vom Büblein auf dem Eise (Der Vater hat’s geklopfet):
Wann hat das angefangen, dass Kirschen im Einzelhandel weit vor August erhältlich sind, ja eigentlich zur Kirschenzeit nur noch die letzten angegorenen Obstreste in Beuteln aus Klarsicht-Erdöl vor sich hingammeln, 8,99 €/kg?
Wie bei den lyrischen Auslassungen über Beerenobst fällt auch bei Kirschen immer wieder der anzügliche Vergleich auf: nämlich von heranreifenden Früchten mit sehr jungen Mädchen, die vorerst nur unter Aufbietung verharmlosender Koketterie zum Geschlechtsverkehr herangezogen werden können. Richtet sich die Lyrik an Kinder, gestaltet sich die Anzüglichkeit immerhin noch als moralinsaures mütterliches Verbot.
Vom Genuss verfrühter Früchte muss in allen, gerade auch allegorischen Fällen abgeraten werden.
——— Wilhelm August Corrodi:
Die Kirschen.
 aus: Fünfzig Fabeln und Bilder aus der Jugendwelt,
aus: Fünfzig Fabeln und Bilder aus der Jugendwelt,
Druck und Verlag von Friedrich Schultheß,
Zürich 1876, Seite 62:
Mutter. Hast du, Kind, es denn vergessen,
Was ich sagte, und gegessen
Von der ganz unreifen Frucht?
Sprich, wo hast du sie gesucht?Kind. Nein, ich habe nichts gegessen,
Bin nur unter’m Baum gesessen,
Schaute nur die Kirschen an,
Böses hab’ ich nichts gethan.Mutter. Schäm’ dich, jetzt erst noch zu lügen;
Alle deine Worte trügen,
Roth ist ja dein ganzer Mund,
Er macht deinen Fehler kund.K. (erschrocken.) Ach, verzeih’ mir, liebe Mutter,
Soll gewiß nicht mehr gescheh’n.Mutter. Nun, ich hoff’ es, denn dem Lügner
Kann es niemals wohl ergeh’n.
Bild: Émile Munier: Le cerisier, 1890.
Soundtrack: Nils Koppruch: Kirschen (wenn der Sommer kommt), aus: Caruso, 2010:
Sie werden stets die Menschheit quälen: – der Teufel selber holt sie nicht
Update zu Was denn sonst, bei diesem Sauwetter
und Gefühl kann man zu Markt nicht bringen, doch Manuskripte jederzeit:
Das ist nun von jenem Heinrich Hoffmann mit dem Struwwelpeter. Die schwarze Pädagogik hält er offensichtlich seit seinem berüchtigten Kinderbuch 1844 durch, aber in der Ballade aus seinen Humoristischen Studien, die aus siebenzeiligen Strophen besteht, muss man sich nicht so um das Seelenheil einer kindlichen Zielgruppe sorgen.
Die Strophenform mit Schema ABABCCB, das sinnvoll begründet vom einem Sonett unterbrochen wird, rettet das Werk vor dem Ruch der Büttenrede.
Moderne Wiedergaben unterschlagen gern die dritte Strophe mit der Anrede an die Muttersprache.

——— Heinrich Hoffmann:
Wie der Teufel den Schwanz verlor
aus: Humoristische Studien, Literarische Anstalt J. Rütten, Frankfurt am Main 1847, Seite 307 bis 320:
Der Teufel hat den Schwanz verloren,
Er sitzt beschämt daheim und klagt.
So hört mir zu, spitzt eure Ohren!
Die Mähr‘ sei nicht umsonst gesagt.
Vor allen euch, Poeten, gilt es;
Bedient euch gleichen Schirms und Schildes,
Wenn euch einmal der Teufel plagt!
Im Schweiß des Angesichts, des blassen,
Saß einst ein Dichterling und schrieb,
Indeß der Schnee, toll ausgelassen,
Sich um die matten Scheiben trieb.
Doch heute ging es nicht, das Reimen,
Trotz zwängen, flicken, biegen, leimen,
Wie er die Stirn‘ auch glühend rieb.
Du gute, deutsche Muttersprache,
Was bist du ein gesundes Weib!
Wie hat mit Folter man und Plage
Zerschunden dir den schönen Leib!
Und doch voll Kraft die jungen Glieder!
Wann kommt dein Simson, daß er wieder
Zu Paaren die Philister treib‘!
Verzweifelnd nagte an dem Kiele
Der Dichter, plötzlich sprang er auf:
„Zum Teufel mit dem dummen Spiele!
Zu was die Waare, wo kein Kauf?
Die ganze Welt hab‘ ich besungen,
Durch Eis und Wüsten mich gerungen;
Zu Bergen steigt der Hefte Hauf.“
„Allein die Menschheit liegt im Argen;
Die Mode gilt bei Buch und Frack.
Den Lorbeerkranz, den dürren, kargen,
Man wirft ihn weg an Lumpenpack.
Indeß sie meinen glühend heißen
Gesängen kalt den Rücken weisen,
Herrscht allwärts dummer Ungeschmack.“
„Was ich euch biet‘, ist lauter Honig;
Ihr lauft, als wär‘ es saurer Wein!
Wie in dem Pestspitale wohn‘ ich
Mit meinen Versen hier allein.
Verdammtes Recensentenwesen!
Hielt Jemand mir nur aus beim Lesen,
Und sollt’s der Teufel selber sein!“
Kaum hat er dieses Wort gesprochen,
So hört er Schritte auf der Flur,
Dann an der Thür ein leises Pochen.
„Ach, war‘ es ein Verleger nur!
Herein! Herein!“ – O Graus und Schrecken!
Er sieht sich durch die Thüre strecken
Des Satan’s höllische Figur.
Mit Horn und Schwanz und Pferdefüßen
Der Teufel, wie er leibt und lebt,
Nach wechselseitigem Begrüßen
Nun also an zu sprechen hebt:
„Ich hörte Euer Wohlgeboren
Hier oben schimpfen und rumoren,
Daß mir das Herz im Leib gebebt.“
„Drum nahm ich mir heraufzukommen
Die Freiheit, und bin gern bereit
Nach Eurem Wunsch, den ich vernommen,
Euch zuzuhören ein’ge Zeit.
Ist gleich das Publikum ein kleines,
So ist’s geduldig doch wie eines
Nur irgend ringsum weit und breit.“
„Ei, seid willkommen mir, Verehrter!“
Rief lauten Jubels der Poet.
„Ich will Euch lesen, Hochgelehrter,
Mit tausend Freuden, wie Ihr seht.
Hier ist ein Stuhl; kommt, laßt Euch nieder!
Roman, Novelle, Drama, Lieder,
Sagt, was Euch zu Befehle steht!“
„Gemach! Zu was so stürmisch eilen?“
Spricht jener: „Glaubt’s ich bleibe hier!
Doch gebt zuvor mir ein paar Zeilen;
So ist’s bei uns Geschäftsmanier.
Ich schüre unterdes das Feuer;
Mich friert’s hier oben ungeheuer.
Ich bin verwöhnt; verzeiht es mir!“
„Erlaubt, daß ich Euch gleich bediene;
Die Kleinigkeit ist flugs gemacht.“
Indeß er schreibt, hat im Kamine
Der Teufel ’s Feuer angefacht;
Und kaum war er damit zu Ende,
So hat der Dichter schon behende
Ein zierlich Blatt ihm dargebracht.
„Den Reim, den ich hier schreibe, sei’s mein letzter,
Den möcht‘ ich recht mit Gift und Galle tränken,
Dich feiles Publikum damit zu kränken,
Ich ein Poet, ein schnöd zurückgesetzter.
Stumpf ist dein Sinn, ein schmählich ungewetzter;
Blind ist dein Aug‘, ja blind den plumpsten Ränken.
Den Tagesaffen magst du dich verschenken,
Ich mag dich nicht, ich ein gehetzt zerfetzter.
Weltmüde bin ich längst ja schon gewesen;
So will ich denn dem Teufel mich verschreiben;
Dem Publikum ruf ich noch: Gott befohlen!
Doch muß der Teufel ruhig sitzen bleiben,
Bis ich ein einzig Trauerspiel gelesen;
Dann kann er mich und meine Verse holen!“
Dem Teufel schien dieß sehr zu munden,
Und schmunzelnd sprach er, lustverklärt:
„Ein jeder hat für freie Stunden
Noch so ein Lieblingssteckenpferd.
Ich nun, ich sammle Autographen.
Welch Glück, daß wir zusammentrafen!
Dieß Blättchen ist mir vieles wert.
Doch jetzt genug, mein lieber Dichter;
Der Worte sind schon viel zu viel!
Seit lang war ich auf nichts erpichter
Als heut‘ auf Euer Trauerspiel.“
Er rückt zwei Sessel mit Behagen,
Und jenen scheint ein Blick zu fragen,
Ob Platz zu nehmen ihm gefiel.
Der Satan setzt sich. – Armer Satan!
Der Handel da gefällt mir nicht.
Ein kluger Mann hört klugen Rath an,
Eh‘ er in Händel sich verflicht. –
Der Dichter aber schließt die Thüre,
Damit ihn heut bei der Lectüre
Kein Unberuf’ner unterbricht.
Der Dichter setzt sich, liest den Namen,
Sodann ein langes Personal.
Was da für Leut‘ zusammenkamen!
Raubmörder, Gauner sonder Zahl,
Buhldirnen, Heuchler, Henkersknechte,
Giftmischer, Pfaffen, geile schlechte,
Und and’re Schufte nach der Wahl.
Dem Teufel läuft’s ob dieser Horde
Wie Eiseskälte durch die Haut.
Er brummt halb ärgerlich die Worte:
„Ich glaube, alter Narr, dir graut!
Was hat der Gimpel denn gelesen,
Als ein Register solcher Wesen,
Wie täglich sie die Hölle schaut?“
Der erste Akt schien noch erträglich;
Der Teufel denkt: „Bald bin ich quitt!“
Im zweiten aber war’s schon kläglich,
Was da er für Gesichter schnitt!
Ihr saht wohl Einen schon sich zwingen,
Zu grobe Bissen zu verschlingen;
So war es, wie der Aermste litt.
Im dritten Akte ward’s noch schlimmer,
Dem Teufel selbst verging der Spaß.
Es häuften Greu’l auf Greu’l sich immer;
Ihm wurde weh, er wurde blaß.
Verstopft hätt‘ er sich gern die Ohren;
Der Angstschweiß brach aus allen Poren;
Bleich saß er, zitternd da und naß.
Der Dichter liest mit neuem Feuer
Den vierten Akt, er glüht und schnaubt.
Des Teufels Angst wird ungeheuer,
Er springt empor, ihm brennt das Haupt,
Er hält den Leib, er dehnt die Glieder,
Geht händeringend auf und nieder,
Er wimmert laut, des Sinns beraubt.
Der fünfte Akt! – Nun gilt’s sich retten!
Er muß in’s Freie, schnappt nach Luft;
Und läg‘ er zehnfach auch an Ketten,
Er muß aus dieser Todtengruft.
Die Thüre, ach! ist fest verschlossen;
Der Teufel hat sich rasch entschlossen.
„Hör‘ auf mit deinem Lesen, Schuft!“
„Verdammter Unsinn! Pfui! Abscheulich!
Die Hölle dankt für solchen Gast!“
Und zum Kamine springt er eilig,
Er klettert aufwärts voller Hast;
Doch wie er eben will verschwinden,
Hat ihn der Dichter rasch von hinten,
Zu rechter Zeit am Schwanz erfaßt.
„Halt Satan! Schurke, trugerfüllter!“
Schreit laut der Dichter, „halte Wort!“ –
Der Teufel zappelt, wüthend brüllt er
Im engen Rauchfang: Feuer! Mord!
Er muß es sich gefallen lassen;
Der Dichter weiß ihn gut zu fassen,
Und liest mit Pathos weiter fort.
Dem Teufel blutet Kopf und Seite.
Da reißt das unglücksel’ge Band,
Und wimmernd sucht er rasch das Weite,
Doch mit dem Schweife in der Hand
Steht der Poet und mit dem Buche.
Erzürnt mit einem derben Fluche
Wirft Schwanz und Heft er an die Wand. –
Als Christen hör‘ ich euch nun fragen
Nach der Moral in dem Gedicht.
Nun seht! Es giebt auf Erden Plagen,
Die dauern, bis die Welt zerbricht.
Viel‘ Dichter sind dahin zu zählen;
Sie werden stets die Menschheit quälen: –
Der Teufel selber holt sie nicht.

Bilder: Jacobus de Teramo: Der Teufel Belial am Tor zur Hölle, aus: Das Buch Belial, Augsburg 1473,
via Danse Macabre, 7. Januar 2014;
Matthias Gerung, Zuschreibung: Der Klerus schlemmt im Rachen eines Teufels, Satire auf den Ablaß, Holzschnitt vor 1536.
Soundtrack: Elvis Presley: (You’re the) Devil in Disguise, 1963:
Filetstück 0007: Kindergeschrei ist auch ein Gesangbuchvers
Update zu Geibels Wesen und Beruf,
Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen,
Uns eine Drehorgel kaufen und unsere eigene Geschichte auf eine Leinwand malen lassen und ein Lied davon machen und es absingen auf allen Gassen des Vaterlandes!
und Frankonachten 5/5: Du bist schon lange gestorben:
Es ist eigentlich eine böse Zeit! Das Lachen ist teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil. Auf der Ferne liegen blutig dunkel die Donnerwolken des Krieges, und über die Nähe haben Krankheit, Hunger und Not ihren unheimlichen Schleier gelegt; – es ist eine böse Zeit!
A. a. O., Anfang.
 Wie schon längst versprochen, wenngleich nur mir selber, habe ich mich unter den Großlangweilern der Weltliteratur zum wiederholten Mal auf das nächste Niveau gewagt: an Wilhelm Raabe.
Wie schon längst versprochen, wenngleich nur mir selber, habe ich mich unter den Großlangweilern der Weltliteratur zum wiederholten Mal auf das nächste Niveau gewagt: an Wilhelm Raabe.
Schon sein Debut Die Chronik der Sperlingsgasse von 1854 f., gedruckt 1857, experimentiert Raabe mit den Erzählkategorien: Der Ich-Erzähler spricht deutlich nicht mit der Stimme des 24-jährigen Autors Raabe, sondern ist in Gestalt des greisen Chronisten „Johannes Wachholder“ ein halb unzuverlässiger Erzähler, der sich eine durchweg assoziative Chronologie, Abschweifungen, persönliche Wertungen und sogar das Eingreifen fremder Erzählerstimmen erlaubt.
Eine der letzteren ist die des leutseligen Karikaturenzeichners „Ulrich Strobel“, der sich über die Auffassung des Deutschtums im späten Biedermeier auslässt, wie sie vermutlich der Autor Raabe selbst vertreten hat. Ich bringe Strobels Gastbeitrag namens Strobeliana zur Chronik, um einen Block gekürzt und mit erklärenden Links zu den Stellen, die der Winkler-Ausgabe eine Anmerkung wert waren.
Mit oder ohne Verlaub meiner versammelten lesenden Bekanntschaft, also nicht allzuvieler Menschen, die allenfalls, dem deutschen Feuilleton folgend, nur zu dessen Jubiläen zwei Minuten lang Gutes über Wilhelm Raabe sprechen, kann ich das für politisch diskutierwürdig, aber ums Verrecken nicht langweilig finden.

——— Wilhelm Raabe:
Strobeliana.
aus: Die Chronik der Sperlingsgasse, 1857; Winkler-Ausgabe Seite 139 bis 143:
3 Uhr. – Ich habe mir eine Zigarre angezündet, den Bogen neben mich ins Fenster gelegt und beginne meine Beobachtungen. […]
Es war an einem Sonntagmorgen im Juli, als ich auf braunschweigschem Grund und Boden am Uferrand der Weser lag und hinüberblickte nach dem jenseitigen Westfalen. Früh vor Sonnenaufgang war ich, über Berg und Tal streifend, mit dem ersten Strahl im Osten in ein gleichgültiges Dorf hinabgestiegen. Ich hatte Kaffee getrunken unter der Linde vor dem Dorfkrug, hatte behaglich das Treiben des Sonntagsmorgens im Dorf belauscht und andächtig der kleinen Glocke zugehört, die in dem spitzen, schiefergedeckten Kirchturm läutete. Manchem hübschen, drallen niedersächsischen Mädchen, das sich über den sonderbaren, plötzlich ins Dorf geschneiten Fremdling wunderte, hatte ich lächelnd zugenickt; ich hatte Bekanntschaft mit der gesamten Kinder-, Hühner-, Gänse- und Entenwelt des „Krugs“ gemacht, dem weißen Spitz den Pelz gestreichelt und manche Frage über „Woher und Wohin“ beantwortet. Mit meinem Wirt (der zugleich Ortsvorsteher war) hatte ich das Bienenhaus besucht, darauf die Gemeinde, den Kantor und Pastor in die Kirche gehen sehen und hatte mich zuletzt allein im Hofe unter der Linde gefunden, nur umgehen von der quackenden, piepsenden geflügelten Schar des Federviehs. Aus diesem dolce far niente hatte mich plötzlich das Schreien eines Kindes aufgeschreckt. Es drang aus dem Haus hinter mir und bewog mich, aufzustehen und in das niedere, vom Weinstock umsponnene Fenster zu sehen. Eine alte Frau war eben beschäftigt, einen widerspenstigen, heulenden, strampelnden Bengel von vier Jahren mit Wasser, Seife und einem wollenen Lappen tüchtig zu waschen, welcher Prozedur drei bis vier andere kleine „Blaen“ angstvoll zusahen, wartend, bis die Reihe an sie kommen würde.
„Nun, Mutter“, sagte ich, mich auf die Fensterbank lehnend; „und Ihr seid nicht in der Kirche?“
Die Alte sah auf und sagte lachend: „Et geit nich immer; ek mott düsse lüttgen Panzen waschen und antrecken – Herre – Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“
Ich nahm den Hut ab und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Welch eine wunderbar schöne Predigt lag in den fünf Worten des alten Weibes! Eine Schwalbe beschrieb eben ihren Bogen um mich, ihrem Neste unter dem niedrigen Dachrande zu, und klammerte sich, ihre Beute im Schnabel, an die Tür ihrer kleinen Wohnung, begrüßt von dem jubelnden Gezwitscher der federlosen Brut. Ich konnte der alten Frau kein Wort mehr sagen.
„Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“ murmelte ich leise, zu meinem Tisch unter der Linde zurückgehend. Ich riß ein Blatt aus meiner Brieftasche, schrieb darauf: Kinderschreien is ok een Gesangbauksversch, und zog es mit einem Strauß Waldblumen unter das Hutband.
Träumend schritt ich dann durch die Tür des Dorfkirchhofs, vorüber an den bunten, geputzten Gräbern, zu dem offnen Kirchtor (auf dem Lande braucht der Protestantismus seine Kirchen während des Gottesdienstes noch nicht zu schließen) und lehnte andächtig an der Esche davor. Mit großer Freude hörte ich, wie der junge Pastor eine Gellertsche Fabel in das Gleichnis aus dem fernen Orient schlang, während die Schwalben in dem heiligen Gebäude hin und her schossen und ein verirrter Schmetterling seinen Weg durch die geöffnete Kirchtür eben wieder zurückfand.
„Kinderschrieen is ok een Gesangbauksversch!“ rief ich, über die niedere Mauer in das freie Feld springend und durch die gelben Kornwogen mit ihrem Kranz von Flatterrosen am Rande der Weser zu wandernd. Da hatte ich mich ins Gras unter einen Weidenbusch geworfen und träumte in das Murren des alten Stromes neben mir hinein, während drüben im katholischen Lande eine Prozession singend den Kapellenberg zu dem Marienbild hinaufzog und hinter mir die protestantischen Orgeltöne leise verklangen. Welch ein wundervoller, blauer, lächelnder Himmel über beiden Ufern, über beiden Religionen, welch eine wogende Gefühlswelt im Busen, anknüpfend an die fünf Worte der alten Bäuerin! Ich war damals jünger als jetzt und legte das Gesicht in die Hände:
„Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles – – –“
Ein näher kommender Gesang weckte mich plötzlich: ich blickte auf. Brausend und schnaufend, die gelben Fluten gewaltig peitschend, kam der „Hermann“ die Weser herunter. Der Kapitän stand auf dem Räderkasten und griff grüßend an den Hut, als das Schiff vorbeischoß. Hunderte von Auswandrern trug der Dampfer an mir vorüber, hinunter den Strom, der einst so viele Römerleichen der Nordsee zugewälzt hatte. Ein Männerchor sang: „Was ist des Deutschen Vaterland„, und die alten Eichen schienen traurig die Wipfel zu schütteln; sie wußten keine Antwort darauf zu geben, und das Schiff flog weiter. Die Weser trägt keine fremden Leichen mehr zur Nordsee hinab, wohl aber murrend und grollend ihre eigenen unglücklichen Söhne und Töchter! – Ich verließ meinen Ruheplatz und ging durch den Buchenwald den nächsten Berg hinauf bis zu einer freien Stelle, von wo aus der Blick weit hinausschweifen konnte ins schöne Land des Sachsengaus. Welch eine Scholle deutscher Erde! Dort jene blauen Höhenzüge – der Teutoburger Wald! Dort jene schlanken Türme – die große germanische Kulturstätte, das Kloster Corvey! Dort jene Berggruppe – der Ith, cui Idistaviso nomen, sagt Tacitus. Ich bevölkerte die Gegend mit den Gestalten der Vorzeit. Ich sah die achtzehnte, neunzehnte und zwanzigste Legion unter dem Prokonsul Varus gegen die Weser ziehen und lauschte ihrem fern verhallenden Todesschrei. Ich sah den Germanicus denselben Weg kommen und lauschte dem Schlachtlärm am Idistavisus, bis der große Arminius, der „turbator Germaniae“, durch die Legionen und den Urwald sein weißes Roß spornte, das Gesicht unkenntlich durch das eigene herabrieselnde Blut, geschlagen, todmüde. Ich sah, wie er die Cheruska von neuem aufrief zum neuen Kampf gegen die „urbs“, wie das Volk zu den Waffen griff: Pugnam volunt, arma rapiunt plebes, primores, juventus, senes!
Aber wo ist denn die Puppe? kam mir damit plötzlich in den Sinn. Ich schleuderte den Tacitus ins Gras, stellte mich auf die Zehen, reckte den Hals aus, so lang als möglich, und schaute hinüber nach dem Teutoburger Walde. Da eine vorliegende „Bergdruffel“ (wie Joach. Heinr. Campe sagt) mir einen Teil der fernen, blauen Höhen verbarg, gab ich mir sogar die Mühe, in eine hohe Buche hinaufzusteigen, wo ich auch das Fernglas zu Hülfe nahm. Vergeblich – nirgends eine Spur vom Hermannsbild! Alles, was ich zu sehen bekam, war der große Christoffel bei Kassel, und mit einem leisen Fluch kletterte ich wieder herunter von meinem luftigen Auslug. Hatte ich aber eben einen leisen Segenswunsch von mir gegeben, so ließ ich jetzt einen um so lautern los. Ich sah schön aus! „Das hat man davon“, brummte ich, während ich mir das Blut aus dem aufgeritzten Daumen sog, „das hat man davon, wenn man sich nach deutscher Größe umguckt: einen Dorn stößt man sich in den Finger, die Hosen zerreißt man, und zu sehen kriegt man nichts als – den großen Christoffel.“ Ärgerlich schob ich mein Fernglas zusammen, steckte den Tacitus zurück in die Tasche und ging hinkend den Berg hinunter wieder der Weser zu. Ärgerlich warf ich mich, am Rande des Flusses angekommen, abermals ins Gras. Was hatte sich alles zwischen die gefühlsselige Stimmung von vorhin und den jetzigen Augenblick gedrängt! Der Himmel war noch ebenso blau, die Berge noch ebenso grün, der Papierstreifen von vorhin steckte noch neben den Waldblumen an meinem Hute, und doch – wie verändert blickte mich das alles an! Hätte das Dampfschiff mit seinen Auswandrern nicht später kommen können, da es doch sonst immer lange genug auf sich warten läßt? Hätte ich Narr nicht unterlassen können, nach dem Hermannsbild auszuschauen? Wie ruhig könnte ich dann jetzt im Grase meinen Mittagsschlaf halten, ohne mich über den großen Christoffel, den so viele brave Katten mit ihrem Blute bezahlt haben, zu ärgern! – Ich versuchte mancherlei, um meinen Gleichmut wiederzugewinnen; ich kitzelte mich mit einem Grashalm am Nasenwinkel, ich porträtierte einen dicken, gemütlichen Frosch, der sich unter einem Klettenbusch sonnte – es half alles nichts! – Der Dämon Mißmut ließ mich nicht los, wütend sprang ich auf, schrie: Hole der Henker die Wirtschaft! und marschierte brummend auf Rühle zu – – – Wetter, was ist das für ein Lärm in der Sperlingsgasse?! Heda – da ist ein Hundefuhrwerk in einen Viktualienkeller hinabgepoltert, und ich – ich, der Karikaturenzeichner Ulrich Strobel, sitze hier und schmiere Unsinn zusammen! Hol der Henker auch die Chronik der Sperlingsgasse! – Adieu, Wachholder!

Bilder:
- die Sperlingsgasse, ehemals Spreestraße in Berlin-Mitte:
-
Zentralbild Klein Bn-Ku. 2 Motive 24.10.1955 Alt-Berlin Ein Stück Alt-Berlin ist die Sperlingsgasse, die durch Wilhelm Raabe’s „Chronik der Sperlingsgasse“ berühmt wurde. Das Haus, in dem Frau Konarske, von den Berlinern „Joldelse“ genannt, die Raabe Diele als Wirtin betreut, ist mit Unterstützung des nationalen Aufbauwerkes renoviert worden. UBz: Raabe Diele und Blick in die Sperlingsgasse.
Bundesarchiv Bild 183-33625-0001, 24. Oktober 1955;
- Fridolin Freudenfett (Peter Kuley), 23. Oktober 2010;
- Achim Bodewig: Haus Sperlingsgasse 1 / Ecke Friedrichsgracht: Wandmosaik Walter Womacka: Der Mensch, das Maß aller Dinge (ursprünglich am Ministerium für Bauwesen, Breite Straße), 13. Dezember 2013;
-
- Thomas Wolf: Hermannsdenkmal 2015, 2. Juli 2015;
- Ralf Roletschek: Herkules-Statue im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, 26. September 2018.
Soundtrack: „Ein Männerchor sang: ‚Was ist des Deutschen Vaterland'“, Ernst Moritz Arndt 1813:
Bonus Track: Hannes Wader: Vaters Land, aus: Wünsche, 2001:
Vom Büblein auf dem Eise (Der Vater hat’s geklopfet)
Update zu Der den Wasserkothurn zu beseelen weiß,
Sie sollen und müssen gerettet sein!,
Was denn sonst, bei diesem Sauwetter
und Meine Urgroßmutter und die Wolken:
Das hat mir meine Großmutter als Das Büblein auf dem Eise beigebracht – korrekt mit dem Dativ-e, ich erinnere mich an nichts anderes – und das, ohne daraus allzu naheliegende zotige Reime abzuleiten.
Lange war mir nicht klar, dass die Leute Wörter wie „heuer“ gar nicht kennen, und wenn es gleich zu Anfang kommt, für alle verbleibenden Strophen verloren sind. Heute erhellt, dass der Dichter Friedrich Güll erstens am 1. April und zweitens im mittelfränkischen Ansbach geboren ist und deshalb fast alles darf, drittens am Heiligabend und viertens in München gestorben ist und deshalb wahrscheinlich nichts damit anfangen konnte, wenn die Leute das handliche „heuer“ mit „in diesem Jahr“ umschreiben müssen.
Wo wir gerade von Strophen reden: Im Originaldruck sind sie auf fünf Verse aufgeteilt. Indem sich die jeweils ersten zwei davon dreihebig binnenreimen, also keine richtigen Alexandriner sind, ergibt das für die Vortragspraxis einwandfrei siebenzeilige Strophen.
Wenn das die Großmutter geahnt hätte. Gemerkt haben es die Illustratorin Gertrud Caspari und ihr – wie ich vermute – Ehemann und Herausgeber Walther Caspari für ihre Ausgabe in: Frühling, Frühling überall! zu Kinderliedern von Friedrich Güll, 1910 und öfter. Ohne an Herrn Gülls unbefugt herumbessern zu wollen, sieht das siebenzueilige Layout doch gleich viel cantabiler aus. Meinen blitzgescheiten, lyrisch bewanderten Lesern gebe ich dennoch Gülls ursprüngliche Schreibweise wieder.
Nach den jugendbildnerischen Begriffen des jungen Jahrtausends fällt die Moral von der Geschicht‘ unter kohlrabenschwarze Pädagogik. Dafür kann meine Großmutter aber nix, und außerdem ist das Gedicht sehr lustig. Und jawohl, schwarze Pädagogik hat mir geschadet.
———- Friedrich Güll:
13. Will sehen was ich weiß
Vom Büblein auf dem Eis.
1827, in: Georg Paysen Petersen, Hrsg.: Mütterchen, erzähl uns was!
Erzählungen, Gedichte, Lieder, Spiele, Rätsel und Sprüche
für Kinderstube und Kindergarten, Verlag von Otto Meißner, Hamburg 1894, Seite 318:
Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis.
Das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis:
„Ich will es einmal wagen,
Das Eis, es muß doch tragen.“ –
Wer weiß?Das Büblein stampft und hacket mit seinem Stiefelein.
Das Eis auf einmal knacket, und krach! schon bricht’s hinein.
Das Büblein platscht und krabbelt
Als wie ein Krebs und zappelt
Mit Schrein.„O helft, ich muß versinken in lauter Eis und Schnee!
O helft, ich muß ertrinken im tiefen, tiefen See!“
Wär nicht ein Mann gekommen,
Der sich ein Herz genommen,
O weh!Der packt es bei dem Schopfe und zieht es dann heraus:
Vom Fuße bis zum Kopfe wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet,
Der Vater hat’s geklopfet
Zu Haus.Bild: Gertrud Caspari für: Gertrud und Walther Caspari, Hrsgg.: Frühling, Frühling überall! zu Kinderliedern von Friedrich Güll, 1925.
Soundtrack: Tori Amos: Winter, aus: Little Earthquakes, 1992:
Kirschwasser
Update zu Ein Mann zwischen den Altern,
Denn „sieben, sieben“, flüstert es stets, und „sieben Wochen“ ihm in das Ohr
und Wo bleibt der Tröster?:
Eins der Bonmots, an die man sich gern vom arg vermissten Harry Rowohlt erinnert, streute er gern nach der ersten Flasche Whiskey ein, die er in seinen „Schausaufen mit Betonung“, die als Autorenlesungen angekündigt waren, verbrauchte: „Wir sind ja hier nicht bei Sarah Kirsch.“
Dergleichen Erlebnisse prägen. Sarah Kirsch hab ich daraufhin nie angefasst. Dann geriet ich in einer schlaflosen Radionacht auf einem unbekannt bleibenden Sender in eine Autorenlesung, die von einer ausgesprochen einnehmenden Frauenstimme bestritten wurde. Da las eine versierte Wortwerkerin aus ihren Gedichten und moderierte von einem zum anderen auf einladend muntere Weise, die jederzeit die nötige Selbstironie beibehielt; das Live-Publikum lachte gelegentlich nicht gerade schallend, aber stillvergnügt und von der Vorstellung ordentlich unterhalten. Man wäre gern dabei gewesen. Wie Sie erraten, war es dann laut Abmoderation Sarah Kirsch in der inhabergeführten Buchhandlung eines deutschen Mittelzentrums, wo eben Autorenlesungen so stattfinden.
Harry Rowohlt kriegt natürlich die Stadthallen und entschieden lauteres Gelächter, aber hey, von dem werden wir’s schon noch ein paarmal haben. Es gibt eine Zeit für Whiskey und eine Zeit für preisbewusstes Mineralwasser, auf das ich Frau Kirsch einschätze. Seit ich sie nächtens im Radio lesen gehört hab, wünsche ich mir von ihr den Seitenhieb „Wir sind ja hier nicht bei Harry Rowohlt“, und er würde nicht nach beleidigter Leberwurst klingen, sondern nach verschmitzter Anspielung für lesungsbewanderte Studienräte. Warum sollen die nicht ihre nerdige Gaudi haben?
 Heute ist Harry Rowohlt so tot wie Sarah Kirsch, was um beide jammerschade ist. Aber von denen reden wir ja gar nicht, sondern von der Droste, die bei uns ja auch nicht oft genug vorkommen kann. Die immer noch weithin unterschätzte, weil auf ein paar ungeliebte Schullektüren reduzierte Freifrau wird von Frau Kirsch als direktes künstlerisches Vorbild genannt, von ihr stammt eine liebevoll kuratierte, gar nicht so schmale (bei KiWi 560 Seiten) Werkauswahl, an sie selbst ging 1997 der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Heute ist Harry Rowohlt so tot wie Sarah Kirsch, was um beide jammerschade ist. Aber von denen reden wir ja gar nicht, sondern von der Droste, die bei uns ja auch nicht oft genug vorkommen kann. Die immer noch weithin unterschätzte, weil auf ein paar ungeliebte Schullektüren reduzierte Freifrau wird von Frau Kirsch als direktes künstlerisches Vorbild genannt, von ihr stammt eine liebevoll kuratierte, gar nicht so schmale (bei KiWi 560 Seiten) Werkauswahl, an sie selbst ging 1997 der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Nun ist uns Insidern längst aufgefallen, dass die Droste sich in ihrer Lyrik gern in siebenzeiligen Strophen äußert, was so weit geht, dass sie ein ausgewachsenes Versepos in dieser Bauart konzipiert, angefangen, durchgezogen und abgeschlossen und dann nicht einmal veröffentlicht hat.
Sarah Kirschs früheste Hommage 1973 an das „Geschenk des Himmels“ der Drostin ist vielleicht, vielleicht auch nicht, absichtsvoll siebenzeilig gebaut. Anspielungen, die nicht gleich jeder Nächstbeste auf Anhieb verstehen muss, hätten Frau Kirsch also gelegen. „Das Wasser reichen“ und dann „Schnäpse in unsre Kehlen gießen“ – Harry Rowohlt hätte begeistert sein können. Wir sind halt hier nicht bei der Droste.
——— Sarah Kirsch:
Der Droste würde ich gern Wasser reichen
1973, aus: Zaubersprüche, 1974, Seite 42
Der Droste würde ich gern Wasser reichen
In alte Spiegel mit ihr sehen, Vögel
nennen, wir richten unsre Brillen
Auf Felder und Holunderbüsche, gehen
Glucksend übers Moor, der Kiebitz balzt
Ach, würd ich sagen, Ihr Lewin –
Schnaubt nicht schon ein Pferd?
Die Locke etwas leichter – und wir laufen
Den Kiesweg, ich die Spätgeborne
Hätte mit Skandalen aufgewartet – am Spinett
Das kostbar in der Halle steht
Spielen wir vierhändig Reiterlieder oder
Das Verbotne von Villon
Der Mond geht auf – wir sind allein
Der Gärtner zeigt uns Angelwerfen
Bis Lewin in seiner Kutsche ankommt
Schenkt uns Zeitungsfahnen, Schnäpse
Gießen wir in unsre Kehlen, lesen
Beide lieben wir den Kühnen, seine Augen
Sind wir grüne Schattenteiche, wir verstehen
uns jetzt gründlich auf das Handwerk Fischen
Bilder: Cover Sarah Kirsch, Hrsg.: Annette von Droste-Hülshoff. Werke.
Ausgewählt von Sarah Kirsch, KiWi 1998, via Amazon.de;
Birgitt Elisabeth Morrien für Coaching Blogger: Mit Skandalen aufzuwarten, 14. Juli 2021.
Soundtrack: Stick and Poke: Poison, aus: Lost Kids, 2014:
Ein alter Moortopf, der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht
Update zu Nicht immer klagen die Nachtigallen:
III
di amseln is des worschd
wos grood fürä brogramm läffd:
sie hockn aff di fernsehandennä
und singä weils
hald einfach singä mäinFitzgerald Kusz: lob der amseln,
aus: seid mei uhr nachm mond gäihd. der gesammelten gedichte dritter teil,
1. Abschnitt: di amseln hamm zeid,
verlag klaus g. renner, München 1984.
Es gibt noch Helden. Deren größter, jedenfalls einziger Dank ist es, wenn ihr Vorhaben funktioniert. Hank Nagler — der das Bildmaterial stiftet — hat 2019 ein Amselnest vor seinem Schlafzimmerfenster gerettet. Hoch und lange soll er leben, solche Leute werden gebraucht.
Weil Hank hoffentlich weder der Einzige noch der Letzte ist, in dessen privaten Liegenschaften sich heimische Singvögel ihre Nester anlegen: Das Gelege der Amsel oder Schwarzdrossel (Turdus merula) besteht normalerweise aus vier bis fünf Eiern; die Brut dauert durchschnittlich etwa zwei Wochen. Das Weibchen übernachtet normalerweise bereits nach Ablage des zweiten Eies im Nest, brütet aber erst ab dem dritten Ei und verlässt das Nest dann nur noch zur Nahrungsaufnahme. Deshalb gedeiht die Brut with a little help from my friends zuverlässiger und besser: Man kann, nach einschätzender Beobachtung sollte man zufüttern — mit Mehlwürmern (lebend oder besser zu handhaben: getrocknet erhältlich im Fachhandel für Tiernahrung, und besser als gar nicht in Gottes Namen auch mal auf Amazon), allen Arten von Beeren (das, was um diese Jahreszeit frisch aufzutreiben ist, oder was man sich ins eigene Müsli schütten würde) sowie hartgekochten und kleingehackten Eiern (und die moralische Diskussion über Kannibalismus bei Vögeln führen wir ein andermal).
Die Brut an Hanks Fenster hat von 22. März bis 14. April 2019 gedauert. Das sind 24 Tage — nach der Angabe bei WIkipedia „zwischen 10 und 19 Tagen, im Mittel bei 13 Tagen„, die sich ihrerseits nach Burkhard Stephan: Die Amsel, 2. Auflage, Neue Brehm Bücherei, Hohenwarsleben 1999 richtet, ungewöhnlich lange. Aufs Jahr, den ökologischen Nutzwert und den persönlichen Gewinn umgerechnet, würde ich deshalb unterstützende Pflege nicht allein mir selber zumuten, sondern auch jedem anderen empfehlen, dem dergleichen widerfährt. Das gute Werk belohnt sich selbst: Am 28. März, ungefähr auf einem Drittel der Strecke, haben die Amselküken einen sichtbaren Fortschritt vollführt und zum ersten Mal aus der Hand gefressen. Ungefähr in diesem Stadium kann man die Mehlwürmer (daher vorzugsweise in getrockneter Form) den Zöglingen in die Schnäbel fallen lassen. Wann das im zeitlichen, regionalen und individuellen Sonderfall geschieht, kommt auf den Versuch an; es wurden sogar schon brütende und — wenngleich „äußerst ungewöhnlich“ — das Weibchen fütternde Amselhähne (nicht etwa „Amselbullen“, wie von Kurt Tucholsky scherzeshalber kolportiert) beobachtet.
Drostes Fragment einer Kriminalgeschichte namens Joseph hat mich spätestens mit seinem Untertitel erwischt: „Nach den Erinnerungen einer alten Frau mitgeteilt von einem alten Moortopf, der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht“ — darauf muss einer erst mal kommen. Die übermütig experimentierfreudige Laune wird eingehalten: Es erinnert viel mehr an Charles Dickens als an durchschnarchte Schulstunden mit der Judenbuche — nicht nur, weil es gleich dem ein Vierteljahrhundert späteren Fragment einer Kriminalgeschichte The Mystery of Edwin Drood von Dickens nicht fertig geworden ist — sondern weil Droste, statt Bewusstseinszustände zu behaupten, sie nach moderner Erzählauffassung anhand der Handlungen ihrer Figuren zeigt, und laut der Deutung von Josefine Nettesheim 1951 einen „feinen Humor, der nur aus der Tragik geboren wird“, pflegt — die Rahmenhandlung zur Verfremdung aus Sicht eines männlichen Ich-Erzählers. Es ist das letzte Fragment, das Droste in ihrem Leben angelegt hat; über jeden Plan zum weiteren Handlungsverlauf lässt sich nur müßig spekulieren.
So ein besagter Moortopf, im Verbreitungsgebiet vom „Limburgischen und wohl auch tiefer nach Holland hinein“ (Wilhelm Kreiten in der Droste-Werkausgabe 1884 bis 1887) verkürzend „Moor“ genannt, also vermutlich in häufigem Gebrauch, ist
jene Art fast kugelförmiger, mit einer engen Abflußröhre und einem kleinen Deckel versehenen gußeisernen Wasserkessel […], welche dortzulande fast den ganzen Tag über dem Herdfeuer hangen, daher schwarz wie ein Mohrenkopf sind und stets Wasser zu einer Tasse Thee oder Kaffee bieten. Die humoristische Anspielung auf den Schreiber ergibt sich hiernach von selbst.
Wonach ich Hank durch meine nicht ganz unbegründete Text- und Bildverquickung in die Nähe der deutschen Ausfertigung eines missmutigen Samowars gerückt hätte. Das wird zu diskutieren sein.
Passend erschien Joseph, weil darin keine Amseln vorkommen. Eine Figur namens Joseph nämlich auch nicht. Das mindeste, was ich tun konnte, war die Version des Erstdrucks in Kreitens Werkausgabe nach der Gesamtausgabe im Insel-Verlag zu möblieren. Es gibt noch Helden, und dann gibt es noch solche wie mich.

——— Annette von Droste-Hülshoff:
Joseph
Eine Criminalgeschichte.
(Rüschhaus 1844–1845)
Nach den Erinnerungen einer alten Frau
mitgetheilt von einem alten Moortopf,
der auf seinem eigenen Herd sitzt und sich selbst kocht.
1845:
Die Zeit schreitet fort. Das ist gut, wenigstens in den meisten Beziehungen. Aber wir müssen mitrennen, ohne Rücksicht auf Alter, Kränklichkeit und angeborene Apathie. Das ist mitunter sehr unbequem.
In meiner Kindheit, wo das Sprichwort: „Bleib im Lande und nähre Dich redlich“ seine strenge Anwendung fand; wo die Familien aller Stände ihre Sprossen wie Banianenbäume nur in den nächsten Grund steckten und die Verwandtschaften so verwickelt wurden, daß man auf sechs Meilen Weges jeden Standesgenossen frischweg: „Herr Vetter“ nannte und sicher unter hundert mal kaum einmal fehlte; in jener Zeit kannte ein ordinairer Mensch mit zehn Jahren jeden Ort, den seine leiblichen Augen zu sehn bestimmt waren und er konnte achtzig Jahre nach einander sich ganz bequem seinen Pfad austreten.
Jetzt ist es anders. Die kleinen Staaten haben aufgehört; die großen werfen ihre Mitglieder umher wie Federbälle, und das ruhigste Subjekt muß sich entweder von allen Banden menschlicher Liebe lossagen oder sein Leben auf Reisen zubringen, je nach den Verhältnissen umherfahrend wie ein Luftballon, oder noch schlimmer immer denselben Weg angähnend wie ein Schirrmeister; kurz, nur die Todtkranken und die Bewohner der Narrenspitäler dürfen zu Hause bleiben, und Sterben und Reisen sind zwei unabwendbare Lebensbedingungen geworden. Ich habe mich nicht eben allzuweit umgesehen, doch immer weiter, als mir lieb ist. Es gibt keine Nationen mehr, sondern nur Kosmopoliten und sowohl Marqueurs als Bauernmädchen in fremdländischen Kleidern. Französische und englische Trachten kann ich auch zu Hause sehen, ohne daß es mir einen Heller kostet. Es macht mir wenig Spaß einer Schweizerin mit großen Hornkämmen in den Haaren fünf Batzen zu geben, damit sie sich in ihre eigene Nationaltracht maskirt oder mir für die nächste Bergtour Tags vorher einen Eremiten in die Klause zu bestellen. Wäre nicht die ewig große, unwandelbare Natur in Fels, Wald und Gebirg (den Strömen hat man auch bunte Jacken angezogen), ich würde zehnmal lieber immer bei den ewigen alten guten Gesichtern bleiben, die mit mir gelebt, gelitten und meine Todten begraben haben.
Nur zwei Gegenden, – ich sage nur, was ich gesehen habe; wo ich nicht war, mögen meinetwegen die Leute Fischschwänze haben, ich bin es ganz zufrieden – mir selbst sind nur zwei Landstriche bekannt geworden, wo ich den Odem einer frischen Volksthümlichkeit eingesogen hatte, ich meine den Schwarzwald und die Niederlande. Dem Erstern kommt wohl die Nähe der Schweiz zu statten. Wer vor dem Gebirge steht, will nichts, als hinüber ins Land der Freiheit und des Alpglühens, der Gems- und Steinböcke, und wer von drüben kommt, nun, der will nichts, als nach Hause oder wenigstens recht weit weg. So rollt das Verderben wie eine Quecksilberkugel spurlos über den schönen, reinen Grund des stolzen Waldes, um erst jenseits zu oxydiren. (Wenn nämlich Quecksilber Oxyd niederschlägt, was ich nicht bestimmt behaupten mag, da ich es nur bis zu Salomon’s Weisheit, d. h. zum Bewußtsein schmählicher Unwissenheit in vielen Dingen zwischen Himmel und Erde gebracht habe.)
Die Niederlande hingegen, dieser von Land- und Wasserstraßen durchzogene und von fremden Elementen überschwemmte Landstrich, bewahrt dennoch in der Natur seines Volksschlages einen Hort Alles abwehrender Eigenthümlichkeit, der besser schützt als Gebirge, die erstiegen und Thalschluchten, die durchstöbert werden können, und den man, nachdem er die neuern Ereignisse überstanden, wohl für unzerstörbar halten darf. Ich war sehr gern in Belgien und hatte alle Ursache dazu, freundliche Aufnahme, noch freundlichere Bewirthung, gänzliche Zwanglosigkeit hinsichtlich meiner Zeitanwendung; es versleht sich, daß ich auf dem Lande und in einer Privatwohnung war. – In Städten und Gasthöfen ist mir immer elend; frische stärkende Spaziergänge durch die Wiesen am Ufer der Maas und vor jedem Hause, jeder Mühle Scenen Wynants und Wouvermanus, Bilder so treu, als wären sie eben von der Leinwand einer niederländischen Meisterschule gestiegen. Das ist es eben, was ich mag. Ob mein alter Tuinbaas vom Kasteel noch wohl lebt? Jetzt müssen seine Tulpen im Flore stehen; aber zehn Jahre sind ein bedenkliches Stück Menschenleben, wenn man sie mit weißen Haaren anfängt – ich fürchte sehr, er hat längst seine Gartenschürze ab- und seine letzte Zipfelmütze angelegt; oder meine gute Nachbarin auf ihrem kleinen Landsitze, dem sie genau das Aussehn eines saubern Wandschränkchens mit Pagodenaufsatz gegeben hatte? Sie war vielleicht nur um sieben bis acht Jahre älter als ich, trug Sommers und Winters Pelzschuhe, und ich konnte barfuß durch den Schnee traben, d. h. ich konnte es vor zehn Jahren, ehe ich mich in einer schwachen Stunde vom faselhänsigen Volk verführen und bereden ließ, auf den Schnepfenstrich zu gehn und ich die Gicht bekam, und wenn ich vollends bedenke, daß ich mich vor einigen Jahren noch verheirathen wollte und zwar an ein blutjunges Mädchen! Doch das sind Thorheiten, corrupte Ideen.
Mevrouw van Ginkels Andenken ist mir werth; sie hatte viel und früh gelitten, und auch von ihrer spätern glücklichern Lage an der Hand eines geachteten und wohlhabenden Gatten, von Brüdern und Schwestern, war ihr nur in einem anständigen Auskommen die Möglichkeit geblieben, ungestört des Vergangenen zu gedenken und jedem Lieblinge unter ihren zahllosen Aurikeln den Namen eines geliebten theuren Verstorbenen geben zu können. Sie war gewiß schön gewesen, so fromme, traurige Augen müssen ja jedes Gesicht schön machen, und gewiß sehr anmuthig, hätte sie auch nichts gehabt, als den bezaubernden Wohlklang ihrer Stimme, die das Alter wahrscheinlich um einige Töne tiefer gestimmt, aber ihr nichts von der jungfräulichen Zartheit genommen hatte, und die jeden Gedanken ihrer Seele zugleich umschleierte und enthüllte und einem Blinden das beweglichste Mienenspiel ersetzen konnte. Welch ein Unterschied, wenn sie bei einer dunklen Aurikel verweilte und in jugendlichem Entzücken sagte: „Das ist meine gute Frau Gaudart,“ und bei einer der blondesten mit großen lichtblauen Augensternen: „Julchen,“ und schnell weiter ging, als fürchte sie, ein fremdes kaltes Auge möge in das Todte ihres Lebens niedersinken.
In meinem Leben bin ich nicht so in Gefahr gewesen, ein sentimentaler Narr zu werden, als bei dieser alten, pünktlichen Mevrouw, die nie klagte, nicht einmal über Migraine oder schlechtes Wetter, deren ganze Unterhaltung sich um Blumenflor, Milchwirthschaft und sonstige kleine Vorfälle ihrer Häuslichkeit bewegte, so z. B. um einige Nachbarskinder, die sie mit Butterbrod und Milch an sichgewöhnt hatte.
Ich glaube wahrhaftig, ich war nahe daran, mich in die alte Person zu verlieben oder wenigstens in eine unbegreiflichc Ueberfülle von Verehrung zu gerathen, weshalb ich denn am liebsten Abends zu ihr ging, wo sie steif hinter der Theemaschine saß, sich mit den Schnörkeln eines Stickmusters abmühend, das die größte Aehnlichkeit mit einem holländischen Garten voll Ziegelbeeten und Taxuspfauen hatte; vor ihr die kleine, goldene Tabatière, rechts und links Etageren voll Pagoden und Muschelhündchen und alles überträufelt von dem feinen Aroma des Kaiserthees.
O VIVANT die Niederlande! das war ein ächter Gerhard Dow, ohne Beimischung, die einen ruhigen Philister hätte stören können – dann wand sich auch das Gespräch fließend ab, und Mevrouw gab sogar mitunter Einiges aus ihren Erlebnissen zum Besten, offenbar mehr in dem Bestreben, einen Gast nach seinem Geschmacke zu unterhalten, als aus eigentlichem Vertrauen, das sie im weiteren Sinne gegen Jedermann im Uebermaß hatte, im engeren Sinne aber Niemand schenkte. Es waren meistens kleine Züge, aber sehr wahre.
Wäre ich ein romantischer Hasenfuß gewesen und hätte ich die Gewohnheit gehabt, meine guten Augen (NB. Wenn mich Jemand sollte zufällig mit Brillen gesehen haben, ich trage nur Conservationsbrillen.) Nachts mit Tagebuchschreiben zu verderben, es stände doch jetzt wohl Manches darin, was ich gerne nochmals läse und was in seiner einfachen Unscheinbarkeit mehr Aufschlüsse über Volk, Zeit und das Menschenherz gäbe, als Manches zehnmal besser Geschriebene. Eine Begebenheit jedoch, vielleicht die einzig wirklich auffallende in Mevrouws Leben habe ich mir später vor und nach notirt und, da meine gute Frau van Ginkel ohne Zweifel längst in ihren Pelzschuhen verstorben ist, mir ferner kein Umstand einfällt, der ihr die Veröffentlichung unangenehm machen könnte, und mein jüngster Neffe, der, Gott sei’s geklagt, sich auf die Literatur geworfen hat, jedoch ein artiges Geld damit verdient, gerade sehr um einen Beitrag in gemüthlichem Stile verlegen ist, so mag er denn den Aufsatz nehmen, wobei ich jedoch bestimmt erkläre, daß ich nur wörtlich der würdigen Frau nachgeschrieben habe und mich sowohl gegen alle poetischen Ausdrücke als überhaupt gegen den Verdacht der Schriftstellerei, als welcher mich bei meiner übrigen Lebensweise und Persönlichkeit nur lächerlich machen könnte, auf’s kräftigste verwahre.
Caspar Bernjen, Rentier.
NB. Den Nachbarn, zu dem Mevrouw redet, und der natürlich Niemand ist, als ich, Caspar Bernjen, Rentier und Besitzer eines artigen Landgutes in Niederschen, müssen der Neffe und der Leser sich als einen ansehnlichen, corpulenten Mann mit gesunden Gesichtsfarben in den besten Jahren mit blauem Rock mit Stahlknöpfen und einer irdenen Pfeife im Munde, an der linken Seite des Theetisches denken. Es geht Nichts über Deutlichkeit und Ordnung in allen Dingen.
~~~\~~~~~~~/~~~
Sie erwähnten gestern eines Umstandes, lieber Herr Nachbar, der sich in Ihrem vierzigsten Jahre ereignet, und über den Sie damals an Ihre Eltern geschrieben. Da hat Ihnen der Himmel ein großes
Glück gegeben.
Ich weiß, was es heißt, keine Mutter haben und den Vater im fünfzehnten Jahre verlieren. Von meiner Mutter habe ich nur ihr lebensgroßes Portrait gekannt, das im Speisesaale hing: eine schöne Frau in weißem Atlas, einen Blumenstrauß in der Hand und auf dem Schooß ein allerliebstes Löwenhündchen. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, daß es meine Mutter war, aber mich dünkt, ich habe nie ein so schönes Gesicht gesehen und nie so sprechende Augen. Ich mag noch nicht daran denken, wie einfältig ich um das Bild gekommen bin, und wie es jetzt vielleicht für Nichts geachtet wird. Warum mein Vater nicht wieder heirathete, begreife ich eigentlich nicht; seine Lage hätte es wohl mit sich gebracht; ein Kaufmann, der den ganzen Tag im Comptoir und auf der Börse zubringt und der Handelsverbindungen wegen fast täglich Gäste zu Tische hat, ist ohne Hausfrau ein geschlagener Mann, allen Arten von Veruntreuungen und Verschleuderungen ausgesetzt, die er unmöglich selbst controliren kann, und sogar seine Commis scheuen sich weniger vor ihm, als vor der Madame, die sie aus- und eingehen sieht, ihre Kleidung und ihr Benehmen gegen die Dienstboten beobachtet und überall in der Stadt Dinge gewahr wird, die dem Herrn sein Lebtage nicht zu Ohren kommen.
Indessen war freilich meine Mutter schon des Vaters zweite Frau gewesen. Die erste hatte ihm ein schönes Vermögen eingebracht und eine erwachsene, damals bereits verlobte Tochter, auf deren Hochzeit sie sich bald nachher ihre tödtliche Krankheit holte durch dünne Kleidung, – man sagt, weil sie als sogenannte junge Frau nicht gar zu matronenhaft neben der Braut hatte aussehen wollen, was sich denn auch in Rücksicht auf ihren Mann wohl begreift; kurz, sie lag acht Tage nachher völlig contract im Bette und hat so sechs Jahre gelegen, zuletzt so elend, daß ihre besten Freunde ihr nur den Tod wünschen mußten.
Nachdem mein Vater anderthalb Jahre Wittwer geblieben, heirathete er ein junges Mädchen von guter Herkunft, aber gänzlich ohne Vermögen. Dies war meine Mutter, und ich mag, Gottlob, fragen, wen ich will, ich höre nur Gutes und Liebes von ihr; aber den Keim zur Schwindsucht soll sie schon in die Ehe mitgebracht haben. Man sieht es auch dem Bilde an, das doch gleich nach der Hochzeit gemalt ist.
Ein Jahr lang bis zu meiner Geburt hielt sie sich noch so leidlich, obwohl das unruhige Leben und die Unmöglichkeit, sich zu schonen, ihr Uebel soll sehr beschleunigt haben. Ich wollte, sie hätte nicht geheirathet; Gott hätte mich ja doch anderwärts erschaffen können; denn, Mynheer, man kommt doch nie ganz darüber weg, seiner Mutter den Tod gebracht zu haben. Man hat mir viel von dem Kummer meines Vaters erzählt und wie er ferner eine Menge Heirathsanträge von der Hand gewiesen. Ich glaube es wohl, denn ich habe nie gesehen, daß er für irgend ein Frauenzimmer das geringste Interesse gezeigt hätte, außer was ihm von der Höflichkeit geradezu auferlegt wurde, und da waren es immer die Mamas und Großmamas, deren Unterhaltung er vorzog; sonst lebte er nur in seinem Geschäfte. Morgens um fünf auf und in seiner Stube gearbeitet, um sechs in’s Comptoir, um elf auf die Börse, von eins bis zweie zu Tische, was vielleicht die schwierigsten Stunden waren, wo er, den Kopf voll Gedanken, den angenehmen Wirth machen mußte.
Nachmittags wieder gearbeitet, Speculationen nachgegangen und zuletzt noch bis Mitternacht in seinem Zimmer geschrieben. Er hat ein saures Leben gehabt.
Ich wuchs indessen in ein paar hübschen Mansardenzimmern bei einer Gouvernante, Madame Dubois, heran und sah mancherlei im Hause, was mir nach und nach anfing wunderlich vorzukommen, so z. B. fast Jeder hatte irgend einen Nachschlüssel, dessen er sich vor mir nicht gerade sehr vorsichtig, aber doch mit einer Art Behutsamkeit bediente, die mich endlich aufmerksam machen mußte. Selbst Madame Dubois hatte einen zur Bibliothek, denn sie brachte ihr Leben mit Romanlesen zu, weßhalb ich denn auch nichts gelernt habe.
Man nimmt sich vor Kindern nicht in Acht, bis es zu spät ist. Hier war es aber leider nicht zu spät; denn als Madame Dubois, die NB. von meiner Kenntniß ihres Schlüssels nichts wußte und nur in Bezug auf Andere sprach, mir auseinandersetzte, daß Schweigen besser sei, als Verdruß machen, war ich noch viel zu jung, um einzusehn, wie höchst nöthig Sprechen hier gewesen wäre. Ich fühlte mich durch ihr Vertrauen noch sehr geehrt, und habe nachher leider Manches noch mit vertuschen helfen. Kinder thun, wie sie weise sind.
Ich sah, so oft mein Vater auf die Börse ging, die Commis wie Hasen am Fenster spähen, bis er um die Gassenecke war, und dann forthuschen, Gott weiß, wohin. Ich sah den Bedienten in meines Vaters seidenen Strümpfen und Schuhen zum Hinterpförtchen hinausschleichen; ich hörte Nachts den Kutscher an meiner Thür vorbeistapfen in den Weinkeller hinunter und wälzte mich vor Aerger im Bette, aber wiedersagen – um Alles in der Welt nicht. Dazu war ich viel zu verständig.
Ich hörte sogar, wie Jemand der Madame Dubois erzählte, unser Kassirer, Herr Steenwick spiele jeden Abend und habe in der vorigen Nacht zwei tausend Gulden verloren und wie die Dubois antwortete:
„Um Gotteswillen, woher nimmt der Mensch das Geld? Da sollte Einem hier im Hause doch schwarz vor den Augen werden!“
Dies war kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag und das erste mal, daß sich mir der Gedanke aufdrängte, Schweigen könne doch auch am Ende seine bedenkliche Seite bekommen.
Das Ding lag mir den ganzen Abend im Kopfe woher H. Steenwick das Geld nehme, ich wußte daß er arm war, er bekam nur 1000 Gulden Gehalt und ich hatte oft gehört daß seine Eltern arme Fischersleute bey Saardam wären. – Ich hatte bey van Gehlens mahl von einem COMMIS gekört, der aus seines Herrn Casse gespielt hatte, und obwohl ich mir das nicht mit einem alten bekannten Gesichte zusammen stellen konnte, was ich im Hause kannte soweit meine Erinnerung reichte, und auch Madame so besonders viel hielt, und noch neulich ein Paar Tragbänder für ihn gestickt hatte, so überfiel mich doch eine instinktartige Angst, die nicht ganz frey von Mistrauen war, und doch immer wieder mit der Erzählung von jenem Commis verschmolz. Madame war still und noch zerstreuter als gewöhnlich, sie zog zehnmal einen Roman unter der Näharbeit hervor, las ein paar Zeilen, steckte ihn wieder zurück und warf endlich fast die Lampe um, und trieb dann hastig zu Bette. Als wir ungefähr eine Stunde zu Bette gewesen waren, Madame und ich, hörten wir uns gegenüber H. Steenwicks Thüre gehn, und dann rasch Tritte über den Gang weg, die Stiege hinunter – es war nicht das erstemahl daß er so spät sein Zimmer verließ, und ich eingeschlafen war ohne ihn zurück kommen zu hören, aber zum ersten Mal bemerkte ich daß er viel schneller ging und seine Stiefel viel weniger knarrten als bey Tage, ich drückte die Kissen von meinem Ohre weg und horchte, im selben Augenblick hörte ich auch Madame ihre Gardine zurück schieben und sich halb im Bette aufrichten, unten im Hausflure schlich ein leises behutsames Knistern, dann ward die Hausthüre erst halb leise dann mit einem raschen Ruck vollends geöffnet, und dann fiel jenseits auf der Gasse ein Schlüssel aufs Pflaster, – Madame seufzte tief, und murmelte „Schweigen schweigen – nur schweigen“ – Ich fühlte einen plötzlichen Muth in mir, und rief, „nein, Madame, Alles an den Papa sagen!“ Sie können sich den Schrecken der armen Frau nicht vorstellen. „Stanzchen!“ rief sie „Stanzchen, schläfst du nicht?“ – und gleich darauf hörte ich sie bitterlich schluchzen, – mir wurde todtangst, ich wußte x-x nicht, daß die arme Person, die in der That eine sehr schlechte Gesundheit und mit ihren 48 Jahren betrübte Aussichten in die Zukunft hatte, ihre ganze Hoffnung auf H. Steenwick setzte, der ihr so lange Bücher voll zarter Liebe die sich nur durch Blicke und feine Aufmerksamkeiten, Blümchen et cet. verrieth, zugeschleppt hatte, bis sie sich um so mehr als halb verlobt ansah, da sie mahl in einem der Bücher an einer sehr bedeutsamen Stelle ein zufälliges Eselsohr fand.
Sie war sonst eine gute ehrbare Person, aber MYNHEER wissen wohl, der Ertrinkende hält sich an einem Strohhalm! – Als Madame sich ein wenig gefaßt bat sie mich vom Himmel zur Erde zu schweigen und log mir sogar etwas vor von einer reichen Tante die dem Cassier oft große Geldgeschenke mache, aber mit so unsicherer Stimme, daß es selbst mir auffiel, endlich versprach sie genau Acht zu geben, sie werde ihr Gewissen sicher nicht mit einer so wichtigen Sache beschweren, obwohl Schweigen sonst immer am Gerathensten sey, wo bey der Untersuchung doch unfehlbar nichts als Verdruß ohne Nutzen herauskommen und aller Schaden und Aufwand auf den Ankläger zurückfallen würde. – „Hat der Herr denn Zeit zu untersuchen?“ sagte sie „frägt er je Jemanden Andren als den Cassier und die Haushälterin? und wenn diese sprechen wollten, haben sie nicht hundertmal die Gelegenheit und die Macht obendrein? – auf Kleinigkeiten, ein paar Steinkohlen mehr oder weniger verbrannt, ein paar Flaschen mehr oder weniger getrunken, kömmt es in einem solchen Hause auch gar nicht an, – aber dies ist zu arg! – Schweig nur, Kind, ich will aufpassen, und wenn es mir vom Himmel auferlegt ist, daß ich mich daran wagen soll, dann in Gottes Namen in Gottes Namen!“ Wenn ich bedenke, in welchem betrübten herzzerreißenden Tone sie dies sagte, so muß ich der armen Frau alle ihre Schwächen vergeben, und bin überzeugt daß sie entschlossen war ihrer Pflicht ein ganzes Lebensglück zu opfern, was freylich nur in der Einbildung bestand, aber MYNHEER, der Wille ist doch so gut wie die That. – Wirklich ging Madame am andern Morgen, gegen ihre Gewohnheit, sehr früh aus, sie kam blaß und niedergeschlagen zurück, packte sogleich ihre Romane und ließ sie H. Steenwick bringen, mit der Bitte ihr keine andern zu schicken, da es ihr vorläufig an Zeit zum Lesen fehle. Von jetzt an horchte ich jeden Abend im Bette, und bemerkte auch daß Madame jeden Abend horchte, aber verstohlen, erst nachdem sie durch die Gardine geschielt hatte ob ich schlafe, und jeden Abend hörte ich H. Steenwick vorbey schleichen und Madames verhaltenes betrübtes Weinen, oft die halbe Nacht durch, den Tag über war Madame wie zerschlagen, griff Alles verkehrt an, hielt die Unterrichtsstunden noch nachlässiger als gewöhnlich, sie saß beständig am Fenster, nähte wie ums Brod, und so oft die COMPTOIRthüre ging fiel eine zerbrochene Nähnadel auf den Boden, auch halb verstohlene Ausgänge wurden mitunter gewagt. – Nach etwa acht Tagen sagte Madame Abends „Stanzchen Morgen spreche ich mit dem Papa“ sie sah hierbey überaus blaß aus, und hatte etwas Edles im Gesicht das mir mehr IMPONIRTE als würde ich gescholten. – Ich legte mich so leise und rücksichtsvoll zu Bette wie in Gegenwart einer Prinzessin, Madame ließ das Licht brennen und laß lange und eifrig im Thomas A KEMPIS; plötzlich fuhren wir Beyde auf, H. Steenwicks Thüre wurde mit Geräusch auf und zu gemacht, und er stampfte einen Gassenhauer pfeifend über den Gang, dann stand er mit einem Mahle still und schien sich zu besinnen oder zu horchen, und dann gings leise leise mit Katzenschritten die Treppe herunter. Der Sand im Flur knirrte, die Hausthür ging, Alles leiser als je, ich sah Madame an, und begegnete einem Ausdrucke des Schreckens der mich betäubte, sie saß aufrecht im Bette, die Hände gefaltet „Jesus Maria!“ war Alles was sie sagte, dann stand sie auf, öffnete das Fenster und lauschte eine Weile hinaus, kam dann schnell zurück, legte sich, und löschte das Licht. – Ich hörte Madame in dieser Nacht nicht weinen, aber so oft ich wach wurde, heftig athmen und sich im Bette bewegen, und ich hörte es oft, denn obwohl ich mir von meinen Gefühlen eigentlich nicht Rechenschaft zu geben wußte hatten doch dieser polternde Gang, dies wilde abgebrochne Pfeifen durch die Stille, und das darauf folgende Katzenschleichen mich mit einem Grausen überrieselt, daß ich mich fast vor den Schnörkeln am Betthimmel und der Gardine fürchtete. – Als es kaum Tag geworden war saß Madame schon wieder aufrecht und sah nach ihrer Taschenuhr, – so mehrere Male – um halb sieben klingelte sie und gab der Magd einen CONFUSEN Auftrag an H. Steenwick – das Mädchen kam zurück – er war noch nicht im COMPTOIR, – „so geh auf sein Zimmer“ – die Thür war verschlossen. – Wir standen auf – von Unterrichtstunden war keine Rede – ich saß mit meinem Strickzeuge in einem Winkel – und Madame saß mit ihrem Nähzeug am Fenster – drey oder viermahl stand sie auf ging in’s Haus hinunter und kam immer blasser wieder. Gesprochen wurde nicht.
Als wir um zwei ins Speisezimmer traten, war mein Vater anfangs nicht da und ließ sagen, wir möchten nur anfangen zu essen. Wir fragten nach dem Buchhalter; er sei bei dem Herrn. Wir aßen um der Domestiken willen einige Löffel Suppe, so sauer es uns wurde.
Da kam der Vater herein, sehr roth und aufgeregt. Er legte sich, gegen seine Gewohnheit, selbst vor, spielte mit dem Löffel und fragte dann, als der Bediente gerade herausging, wie hingeworfen:
„Madame, Sie wohnen doch dem Cassirer gegenüber; wissen Sie nicht, wann er diesen Morgen ausgegangen ist?“
Ueber Madames Gesicht flog eine glühende Röthe, die einem wahrhaft edlen Ausdrucke Platz machte. Sie stand auf und sagte mit fester Stimme:
„Mynheer, Herr Steenwick ist diese Nacht nicht im Hause gewesen.“
Mein Vater sah sie an mit einem Gesichte, das mehr Angst als Bestürzung verrieth. Er stand auf, gab draußen einige Befehle und setzte dann sein Verhör fort.
„Haben Sie gestern bemerkt, wann er fortging?“
„Ja, Mynheer, um halb zwölf,“ und nach einigem Zögern setzte sie hinzu, „haben wir, Stanzchen und ich, ihn fortschleichen hören.“
„Fortschleichen?“ rief mein Vater und wurde fast eben so blaß als Madame. „Also doch wahr! Seien Sie aufrichtig, Madame, war es zum ersten Male?“ Es war, als sinke die arme Frau in sich zusammen, als sie stammelnd antwortete:
„Nein, Mynheer, nein, schon seit acht Tagen jeden Abend.“
Mein Vater sah sie starr an.
„O Mynheer, fragen Sie Stanzchen. Stanzchen weiß, daß ich es Ihnen heute sagen wollte.“
Mein Vater antwortete nicht. Er ging hastig an einen Wandschrank, der Feile, Kneifzangen und allerlei Schlüssel enthielt. Dann rief er an der Thür heftig nach dem Buchhalter. Thüren gingen und als eben ein Bedienter Speisen hereintrug, hörten wir an einem Krach, daß im Kabinet neben dem Comptoir die Kasse erbrochen wurde.
Wir saßen wie Bildsäulen am Tische, ließen eine Speise nach der andern abtragen und hatten weder den Muth, das Zimmer zu verlassen, noch darin zu bleiben.
Der Vater kam nicht wieder, auch zum Abendessen nicht, auch zum nächsten Mittagessen nicht, der Buchhalter eben so wenig.
Die jungen Commis schlenderten im Hause umher, und wir merkten aus einzelnen Worten, daß Herr Steenwick für in wichtigen Geschäften verschickt galt; denn zum Nachfragen hatte Keines von uns Muth.
Am zweiten Abend stürzte der Buchhalter aus dem Kabinet und rief: „Wasser! Um Gottes Willen, Wasser! Und geschwind zum Doktor Velten; der Herr hat einen Blutsturz bekommen.“
Madame und ich hörten das Geschrei auf unserm Zimmer, und ich weiß nicht, wie wir die Treppen hinuntergekommen sind, ich weiß nur, daß mein lieber Vater in seinem ledernen Arbeitssessel saß, bleich wie der Tod, die Augen halb gebrochen, ängstlich umherfahrend und daß er mich noch mit einem langen, traurigen Blicke ansah, daß mich schauderte, als ich in einen Blutstrom trat, der uns schon auf dem Entree entgegen floß.
Als Doktor Velten kam, war ich eine arme, verlassene Waise.
Von dem, was zunächst geschah, kann ich nur wenig sagen. Ich verstand das Meiste nur halb, und es schien mir Alles wie Nichts nach dem, was geschehen.
Das Gesinde mußte wohl wissen, wie mir zu Muthe war; denn wenn ich einmal zufällig mein Zimmer verließ, sah ich sie ziemlich offen silberne Bestecke, Becher und dergleichen auf ihre Kammern tragen. Ich sah es und sah es auch nicht; hätte ich nachher darüber aussagen sollen, ich hätte die Thäter nicht zu nennen gewußt.
Es war mir, als müßte ich ersticken, wenn der Weihrauchdampf bis oben in’s Haus zog. Ich hörte unter unsern Fenstern die Trauermusik, sah die Fackeln wiederscheinen und verkroch mich hinter’s Bett mit dem glühendsten Wunsch zu sterben.
Dann zog man mir schwarze Kleider an, und mein Vormund, der Banquier van Gehlen, holte mich vorläufig in sein Haus.
Madame Dubois mußte zurückbleiben. Unser Abschied war sehr schmerzlich, und es vergingen mir fast die Sinne, als diese Frau, der ich so lange gehorcht hatte, auf den Knieen zu mir hinrutschte,
meine Hand küßte und rief:„Stanzchen, Stanzchen vergib mir! Ich bin an Allem Schuld! O Gott, ich bin eine alte Thörin gewesen!“
Es war mir, als sollte ich ihr um den Hals fallen, aber ich blieb steif stehen mit vor Scham geschlossenen Augen und als ich sie aufmachte war Madame fort, und statt ihrer hielt Herr van Gehlen mich bei der Hand.
Unsere Vermögensumstände stellten sich dann, wie Sie wohl erwartet haben, sehr traurig heraus. Mein Vater hatte eine Staatsanleihe übernommen und sich sehr um dies Geschäft beworben, da wir keineswegs zu den ersten Häusern in Gent gehörten. Ob schon Gelder eingegangen und versendet waren, weiß ich nicht, aber 600,000 Gulden waren aus der Kasse verschwunden. Das war gerade unser eigenes Vermögen, den Brautschatz meiner Schwester, den sie im Geschäft gelassen hatte, eingerechnet; so blieb mir nicht das Salz auf dem Brode.
In van Gehlens Hause wollte man gütig gegen mich sein; aber es war dort nichts wie Glanz und Pracht. Man ließ mir Freiheit auf meinem Zimmer, aber das Lachen, Klavierspielen und Wagenrollen schallte von unten herauf und, wenn ich mich sehen ließ, gab es eine plötzliche Stille, wie wenn ein Gespenst erschien, und Aller Augen waren auf mich gerichtet, als gäbe es außer mir keine verarmte Waise in Gent.
Mevrouw van Gehlen that zwar ihr Möglichstes, mir über solche Augenblicke weg zu helfen; aber selbst ihr Bestreben that mir weh und ließ es mich erst recht fühlen, wie viel hier zu verbergen war.
Täglich hoffte ich auf die Ankunft meiner Stiefschwester; sie kam nicht, auch mein Schwager nicht, sondern nur ihr Geschäftsmann, Herr Pell, der mich so quer ansah, als hätte ich seinen Patron bestohlen, – schon gleich anfangs und noch schlimmer, nachdem er sich einige Stunden mit Mynheer van Gehlen eingeschlossen.
Dennoch hatte er den Auftrag, mich mitzuhringen, wenn sich nämlich kein anderes Unterkommen fände.
Ich stand bei dieser Verhandlung zitternd wie Espenlaub und nahm jeden lieblosen Ausdruck des kleinen, hagern Mannes für direct aus dem Munde meiner Schwester; woran ich doch gewiß sehr Unrecht hatte. Denn ich bin später, nach meiner Verheirathung, öfters mit ihr zusammen gewesen in ihrem Hause und auch in dem meinigen, und sie war zwar eine etwas förmliche Frau, aber immer voll Anstand und verwandtschaftlicher Rücksicht, und sie hat es mir sogar viel zu hoch angerechnet, als ich ihr nach meines Mannes Tode ihre durch unser Unglück erlittenen Verluste zu ersetzen suchte, was doch nicht mehr als meine allerstrengste Pflicht war.
Die Conferenz im Fenster war noch im besten Gange, als Herrn van Gehlen ein Besuch gemeldet wurde. Den Namen verstand ich nicht und benutzte diesen Augenblick, mich unbemerkt fortzuschleichen.
Im Vorzimmer traf ich den Fremden, einen kleinen, geistlich gekleideten, hagern Mann, der beschäftigt war, sich mit einem bunten Schnupftuche den Staub von den Aermeln zu putzen. Er sah scharf auf und seine Augen verfolgten mich bis in die Thür mit lebhafter Neugierde.
Hast Du auch noch keine verarmte Waise gesehen? dachte ich.
Nach einer halben Stunde, die mir unter großer Gemüthsbewegung und unter Nachdenken über meine Schwester verging, ward ich heruntergerufen.
Ich fand die drei Herrn zusammen. Mynheer van Gehlen und Herr Pell saßen vor dem Tisch und blätterten in dicken Papierstößen. Sie sahen roth und angegriffen aus. Herr Pell schlug die Augen nicht vom Papier auf. Van Gehlen lächelte verlegen und schien mir etwas sagen zu wollen, als der Fremde aus der Fensternische trat, meine beiden Hände ergriff und mit bewegter Stimme sagte:
„Stanzchen, Stanzchen, ich bin Dein Ohm. Hat Dir denn Papa niemals von dem alten Herrn Ohm Pastor erzählt, dem alten Pastor in G.?“
Ich war ganz verwirrt; doch kamen mir einige dunkle Erinnerungen, obwohl mein Vater selten frühere Verhältnisse berührte.
So küßte ich dem Onkel die Hand und sah ihn auf eine Weise an, die ohne Zweifel etwas kümmerlich gewesen sein muß, denn er sagte:
„Sei zufrieden, Kind; Du sollst nicht nach Roeremonde. Du gehst mit mir;“ und dann mit erhöhter Stimme halb zu den Andern gewendet:
„Wenn ich gleich keine feine Juffrouw erziehen kann, so sollst Du doch rothe Backen kriegen und auch nicht wild aufwachsen, wie eine Nessel im Hagen.“
Mynheer van Gehlen nickte zustimmend. Pell schlug seine Actenstöße zu und sagte:
„Wenn Ewr. Ehrwürden das so wollen – vorläufig wenigstens. Ich will es an meinen Patron berichten; vielleicht – sonst steht der Juffrouw Roeremonde alle Tage offen.“
Mein Ohm machte eine feierliche Verbeugung: „Gewiß, ja, wir lassen Mevrouw danken. Roeremonde steht alle Tage offen – aber Mevrouw muß mir das Kind lassen. Es ist meiner Schwester Kind, die ich sehr lieb gehabt habe, wenn sie auch nur meine Stiefschwester war.“
Niemand antwortete. Ich fühlte, daß hier irgend ein drückendes Mißverständniß herrschte, und war froh, als mein Onkel gütig fortfuhr:
„Nun, Stanzchen, ich kann aber nicht lange von Hause bleiben; pack Deine Siebensachen und dann danke Mynheer und Mevrouw van Gehlen, daß sie Dich armes, verlassenes Kind so treulich aufgenommen haben.“
Zwei Stunden darauf saßen wir im Wagen. So bin ich von Gent gekommen. Noch muß ich Ihnen sagen, daß Herr Steenwick nicht, nachdem er des Vaters Kasse zum Theil verspielt, mit dem Ueberreste durchgegangen war, wie Sie ohne Zweifel glauben und auch Jedermann damals glaubte.
Nach drei Wochen kam sein Leichnam auf in der Schelde. Er hatte nichts in der Tasche, als seine gewöhnliche grüne Börse mit 6 Stuyvern darin und einen kleinen leeren Geldsack, den er aus angewöhnter Pünktlichkeit mußte mechanisch wieder eingesteckt haben. Man hätte eigentlich zuerst hierauf verfallen sollen, da von seinen Habseligkeiten nicht das Geringste vermißt wurde, nichts als die Kleider, die er am Leibe trug und seine alte silberne Uhr.
Aber die Leute denken gern immer das Schlimmste. Lieber Gott, es ist freilich schlimm genug, Anderer Leute Geld zu verspielen und dann – ein solches Ende! Aber Mynheer wissen wohl, es kommt einem doch nicht so schimpflich vor, als ein anderer Diebstahl.
Ein Spieler ist wie ein Betrunkener, wie ein Besessener, aus dem der Böse handelt wie eine zweite fremde Seele. Habe ich nicht Recht? Herr Steenwick hatte unserm Hause zwanzig Jahre lang gedient, hatte so manche Nächte durchgearbeitet und auch nicht ein Endchen Bindfaden verkommen lassen; er war wahrhaftig noch grimmiger auf’s Geschäft verpicht, als der Herr selbst, und nun ein solches Ende!
Indessen hat er, Gottlob, doch noch ein ehrliches Grab bekommen, weil sich mehrere Leute fanden, die ihn in der Morgendämmerung hatten taumeln sehen, wie einen Betrunkenen, und zwar in der Richtung nach Hause zu. So wurde denn angenommen, er habe, wie unglückliche Spieler häufig, sich zu viel Courage getrunken und sei so ohne Absicht dem Scheldeufer zu nahe gekommen.
Madame Dubois soll nachher auch noch heimlich auf sein Grab ihren Balsaminenstock gepflanzt haben, ist aber doch dabei belauscht worden – die arme Seele! Sie war wirklich gut von Natur, nur durch Romanenlesen etwas confus geworden; und wußte nicht recht mehr, ob sie alt oder jung war, und auch zu furchtsam geworden durch das Gefühl ihrer abhängigen Lage und noch mehr ihrer täglich abnehmenden Fähigkeit, sich selbst zu ernähren. Aber ihr Wille war immer der beste, und sie suchte mich vor jedem schädlichen Eindruck mit einer Treue zu hüten, für die ich ihr im Grabe noch dankbar bin.
Jetzt ist sie lange, lange todt; sie starb schon das Jahr darauf, als ich zu meinem Ohm kam, und ihre Ersparnisse in unserm Dienste haben übrig ausgereicht bis an ihr Ende.
So quälen wir uns oft umsonst, und unser Herrgott lacht dazu. –
~~~\~~~~~~~/~~~
Hier schien Mevrouw van Ginkel ihre Mittheilungen endigen zu wollen. Sie schüttete frischen Thee auf, nahm eine Prise aus ihrem goldenen Döschen und sah mich mit jenem wohlwollenden Blicke an, der bei höflichen Leuten den Wunsch, auch den Andern zu hören, ausdrückt. Ihr Gesicht war völlig ruhig, sogar lächelnd; doch hing etwas Glänzendes in ihren Augwimpern, das aber nicht weiter kam.
Ich hingegen war in eine Stimmung gerathen, worauf ich eigentlich gar nicht für diese Stunde gerechnet hatte, und hätte für mein Leben gern Mevrouw in ihrer Dorfwirthschaft gesehen, um so mehr, da unschuldige Kinder sowohl wie alte Junggesellen mir ein gleich starkes Interesse erregen und man beide selten, wie hier, vereinigt findet.
So that ich einige blinde Fragen nach der Lage des Dorfes und wie viel Diensthoten und wie viel Kühe u.s.w. Mevrouw errieth meine Absicht und sagte sehr freundlich:
„Ich sehe wohl, Mynheer interessiren sich für meinen guten Ohm und gewiß hat es auch nie einen bessern Mann gegeben – und keinen ehrwürdigern,“ fügte sie hinzu mit einem Ausdruck kindlicher Scheu, der ihr fast wieder das Ansehn einer kleinen, wohlerzogenen Jungfer von vierzehn Jahren gab.
„Indessen läßt sich wenig von unserm Leben sagen. Es war sehr einfach und so einförmig, daß, wenn nicht die Kirchenfeste und die Jahreszeiten gewesen wären, unsere Tage einander so gleich gewesen wären wie Wassertropfen.“
Hier schüttete sie Wasser auf den Thee, und ich betrachtete einen am Kessel hängenden Tropfen, der allerdings wenig Unterhaltung zu versprechen schien.
„Aber,“ fuhr sie fort, „so sollte es nicht bleiben, und ich möchte dem Herrn Nachbar wohl die Catastrophe von meines Ohms, ich kann wohl sagen, von meinem Schicksal erzählen, damit Sie sehen, was der, dem ich am meisten in der Welt zu danken habe, für ein Mann war. Aber da ist eine andere kuriose Geschichte hinein verflochten, die Mynheer gewiß interessiren würde, aber etwas lang ist. Haben Mynheer sich auch gut gegen die Abendluft verwahrt?“
Ich versicherte, daß ich alle nöthigen Maßregeln getroffen, obwohl ich, ehrlich gesagt, heute zum ersten Mal meine dritte Weste ausgelassen hatte und mit einiger Sorge an den Thau dachte.
Jedoch hatte ich Mevrouw noch nie in so mittheilender Stimmung gesehn und war entschlossen, diese zur Erweiterung meiner Menschenkenntniß um jeden Preis zu benutzen. So betheuerte ich, daß ich nie nach dem Thee noch zu Abend esse, – was auch wahr ist – und mir längst eine gelegentliche Mondscheinpromenade am Maasufer vorgenommen hätte, was allerdings nicht ganz mit meinem sonstigen Geschmacke und meinen sonstigen Gewohnheiten übereinstimmte.
Mevrouw sah mich auch so verwundert an, als mache vor ihren Augen eine Schildkröte Vorbereitungen auf den Hinterbeinen zu spazieren; jedoch fuhr sie ohne weitere Bemerkungen in ihren Mittheilungen fort, nur zuweilen kleine Pausen machend, um mir einzuschenken oder ihrem goldenen Döschen zuzusprechen, wobei sie mich in so wohlwollender Weise zum Mitgenuß einlud, daß ich bei mir an die Friedenspfeife der Indianer denken mußte; welche Unterbrechungen ich durch Absätze bezeichne und dem Leser die Ausmalung der kleinen Zwischenspiele überlassen werde. Also Mevrouw fuhr fort:
[nicht vollendet]
Soundtrack: The Beatles: Blackbird, aus dem Weißen Album: The BEATLES, 1968.
Schönes Lied; den Ohrwurm kann man leicht zehn Stunden ausleben:
Bonus Track: auch Beatles, aus: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967,
aber von Joe Cocker and The Grease Band: With a Little Help from My Friends,
live in Woodstock, Sonntag, 17. August 1969, ca. 15.15 Uhr Ortszeit:
Filetstück 0002: Eisbruch
Update zu Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen
und Wenn–dann (weiß ich auch nicht):
Da mag einer von Adalbert Stifter (* 23. Oktober 1805; † 28. Jänner 1868), vor allem vom späten, so wenig und so viel Abfälliges halten wie er will, aber sein Perfektionismus ging weit genug, um Die Mappe meines Urgroßvaters gleich viermal zu schreiben — bei weitem nicht seine einzige Arbeit, die er mehrmals von Grund auf neu schrieb.
Ein erstes Kapitel Die Geschichte zweier Bettler, noch ohne Plan zum Einbau in einen größeren Rahmen, stammt von 1839, die kürzeste „Urmappe“ oder „Journalfassung“ in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode von 1841/1842, die erweiterte und in der Kapitelstruktur umgebaute „Studienfassung“ im dritten Band der Studien von 1847, eine unvollendet liegen gelassene und weitgehend folgenlos gebliebene „Romanfassung“ von 1864, die „letzte Mappe“ mit 164 Manuskriptseiten noch aus Stifters Todesjahr 1868 — ebenfalls fragmentarisch und mit dem seither grundsätzlich übernommenen Zusatz vom Nachlassverwalter und posthumen Herausgeber Johann Aprent: „Hier ist der Dichter gestorben.“
Das macht Stifters erklärten eigenen Lieblingsstoff zu einem ähnlichen Lebenswerk wie den Faust für Goethe — nur in allen Fassungen schlüssiger als Goethes nach lebenslanger Umarbeitung endlich freigegebenes Stückwerk. Die Fassungen der Mappe sind erst seit 1999 im 6. Band der historisch-kritischen Gesamtausgabe grundlegend erschlossen.
Der Abschnitt, der als „Eisbruch“ kursiert, war in der ersten Fassung noch nicht, in der dritten nicht mehr enthalten; allein in der Studienfassung steht er unscheinbar ins Kapitel Margarita eingearbeitet. Dabei gehört der zum Besten, was Stifter je geschrieben hat: Man friert mit.

——— Adalbert Stifter:
4. Margarita
aus: Die Mappe meines Urgroßvaters, „Studienfassung“ 1841 f., in: Studien, Band III, 1847:
Wir mußten einen schweren Winter überstehen. So weit die ältesten Menschen zurück denken, war nicht so viel Schnee. Vier Wochen waren wir einmal ganz eingehüllt in ein fortdauerndes graues Gestöber, das oft Wind hatte, oft ein ruhiges, aber dichtes Niederschütten von Flocken war. Die ganze Zeit sahen wir nicht aus. Wenn ich in meinem Zimmer saß und die Kerzen brannten, hörte ich das unablässige Rieseln an den Fenstern, und wenn es licht wurde und die Tageshelle eintrat, sah ich durch meine Fenster nicht auf den Wald hin, der hinter der Hütte stand, die ich hatte abbrechen lassen, sondern es hing die graue, lichte, aber undurchdringliche Schleierwand herab; in meinem Hofe und in der Nähe des Hauses sah ich nur auf die unmittelbarsten Dinge hinab, wenn etwa ein Balken empor stand, der eine Schneehaube hatte und unendlich kurz geworden war, oder wenn ein langer, weißer, wolliger Wall anzeigte, wo meine im Sommer ausgehauenen Bäume lagen, die ich zum weitern Baue verwenden wollte. Als alles vorüber war und wieder der blaue und klare Winterhimmel über der Menge von Weiß stand, hörten wir oft in der Totenstille, die jetzt eintrat, wenn wir an den Hängen hinunter fuhren, in dem Hochwalde oben ein Krachen, wie die Bäume unter ihrer Last zerbrachen und umstürzten. Leute, welche von dem jenseitigen Lande über die Schneide herüber kamen, sagten, daß in den Berggründen, wo sonst die kleinen, klaren Wässer gehen, so viel Schnee liege, daß die Tanne in von fünfzig Ellen und darüber nur mit den Wipfeln heraus schauen. Wir konnten nur den leichteren Schlitten brauchen – ich hatte nämlich noch einen machen lassen –, der etwas länger, aber schmäler war als der andere. Er fiel wohl öfter um, aber konnte auch leichter durch die Schlachten, welche die Schneewehen bildeten, durchdringen. Ich konnte jetzt nicht mehr allein zur Besorgung meiner Geschäfte herum fahren, weil ich mir mit allen meinen Kräften in vielen Fällen allein nicht helfen konnte. Und es waren mehr Kranke, als es in allen sonstigen Zeiten gegeben hatte. Deswegen fuhr jetzt der Thomas immer mit mir, daß wir uns gegenseitig beistünden, wenn der Weg nicht mehr zu finden war, wenn wir den Fuchs aus dem Schnee, in den er sich verfiel, austreten mußten, oder wenn einer, da es irgendwo ganz unmöglich war durch zu dringen, bei dem Pferde bleiben und der andere zurück gehen und Leute holen mußte, damit sie uns helfen. Es wurde nach dem großen Schneefalle auch so kalt, wie man es je kaum erlebt hatte. Auf einer Seite war es gut; denn der tiefe Schnee fror so fest, daß man über Stellen und über Schlünde gehen konnte, wo es sonst unmöglich gewesen wäre; aber auf der andern Seite war es auch schlimm; denn die Menschen, welche viel gingen, ermüdet wurden und unwissend waren, setzten sich nieder, gaben der süßen Ruhe nach, und wurden dann erfroren gefunden, wie sie noch saßen, wie sie sich nieder gesetzt hatten. Vögel fielen von den Bäumen, und wenn man es sah und sogleich einen in die Hand nahm, war er fest wie eine Kugel, die man werfen konnte. Wenn meine jungen Rappen ausgeführt wurden und von einem Baume oder sonst wo eine Schneeflocke auf ihren Rücken fiel, so schmolz dieselbe nicht, wenn sie nach Hause kamen, wie lebendig und tüchtig und voll von Feuer die Tiere auch waren. Erst im Stalle verlor sich das Weiß und Grau von dem Rücken. Wenn sie ausgeführt wurden, sah ich manchmal den jungen Gottlieb mit gehen und hinter den Tieren her bleiben, wenn sie auf verschiedenen Wegen herum geführt wurden, aber es tut nichts, die Kälte wird ihm nichts anhaben, und er ist ja in den guten Pelz gehüllt, den ich ihm aus meinem alten habe machen lassen. Ich ging oft in die Zimmer der Meinigen hinab, und sah, ob alles in der Ordnung sei, ob sie gehörig Holz zum Heizen haben, ob die Wohnung überall gut geborgen sei, daß nicht auf einen, wenn er vielleicht im Bette sei, der Strom einer kalten Luft gehe und er erkranke; ich sah auch nach der Speise; denn bei solcher Kälte ist es nicht einerlei, ob man das oder jenes esse. Dem Gottlieb, der nur mit Spänen heizte, ließ Ich von den dichten Buchenstöcken hinüber legen. Im Eichenhage oben soll ein Knall geschehen sein, der seines Gleichen gar nicht hat. Der Knecht des Beringer sagte, daß einer der schönsten Stämme durch die Kälte von unten bis oben gespalten worden sei, er habe ihn selber gesehen. Der Thomas und ich waren in Pelze und Dinge eingehüllt, daß wir zwei Bündeln, kaum aber Menschen gleich sahen. Dieser Winter, von dem wir dachten, daß er uns viel Wasser bringen würde, endigte endlich mit einer Begebenheit, die wunderbar war, und uns leicht die äußerste Gefahr hätte bringen können; wenn sie nicht eben gerade so abgelaufen wäre, wie sie ablief. Nach dem vielen Schneefalle und während der Kälte war es immer schön, es war immer blauer Himmel, morgens rauchte es beim Sonnenaufgange von Glanz und Schnee, und nachts war der Himmel dunkel wie sonst nie, und es standen viel mehr Sterne in ihm als zu allen Zeiten. Dies dauerte lange – aber einmal fiel gegen Mittag die Kälte so schnell ab, daß man die Luft bald warm nennen konnte, die reine Bläue des Himmels trübte sich, von der Mittagseite des Waldes kamen an dem Himmel Wolkenballen, gedunsen und fahlblau, in einem milchigen Nebel schwimmend, wie im Sommer, wenn ein Gewitter kommen soll – ein leichtes Windigen hatte sich schon früher gehoben, daß die Fichten seufzten und Ströme Wassers von ihren Ästen niederlassen. Gegen Abend standen die Wälder, die bisher immer bereift und wie in Zucker eingemacht gewesen waren, bereits ganz schwarz in den Mengen des bleichen und wässerigen Schnees da. Wir hatten bange Gefühle, und ich sagte dem Thomas, daß sie abwechselnd nachschauen, daß sie die hinteren Tore im Augenmerk halten sollen, und daß er mich wecke, wenn das Wasser zu viel werden sollte. Ich wurde nicht geweckt, und als ich des Morgens die Augen öffnete, war alles anders, als ich es erwartet hatte. Das Windchen hatte aufgehört, es war so stille, daß sich von der Tanne, die ich keine Büchsenschußlänge von meinem Fenster an meinem Sommerbänkchen stehen sah, keine einzige Nadel rührte; die blauen und mitunter bleifarbigen Wolkenballen waren nicht mehr an dem Himmel, der dafür in einem stillen Grau unbeweglich stand, welches Grau an keinem Teile der großen Wölbung mehr oder weniger grau war, und an der dunkeln Öffnung der offen stehenden Tür des Heubodens bemerkte ich, daß feiner, aber dichter Regen niederfalle; allein wie ich auf allen Gegenständen das schillerige Glänzen sah, war es nicht das Lockern oder Sickern des Schnees, der in dem Regen zerfällt, sondern das blasse Glänzen eines Überzuges, der sich über alle die Hügel des Schnees gelegt hatte. Als ich mich angekleidet und meine Suppe gegessen hatte, ging ich in den Hof hinab, wo der Thomas den Schlitten zurecht richtete. Da bemerkte ich, daß bei uns herunten an der Oberfläche des Schnees während der Nacht wieder Kälte eingefallen sei, während es oben in den höheren Teilen des Himmels warm geblieben war; denn der Regen floß fein und dicht hernieder, aber nicht in der Gestalt von Eiskörnern, sondern als reines, fließendes Wasser, das erst an der Oberfläche der Erde gefror und die Dinge mit einem dünnen Schmelze überzog, derlei man in das Innere der Geschirre zu tun pflegt, damit sich die Flüssigkeiten nicht in den Ton ziehen können. Im Hofe zerbrach der Überzug bei den Tritten noch in die feinsten Scherben, es mußte also erst vor Anbruch des Tages zu regnen angefangen haben. Ich tat die Dinge, die ich mitnehmen wollte, in ihre Fächer, die in dem Schlitten angebracht waren, und sagte dem Thomas, er solle doch, ehe wir zum Fortfahren kämen, noch den Fuchs zu dem untern Schmied hinüber führen und nachschauen lassen, ob er scharf genug sei, weil wir heute im Eise fahren müßten. Es war uns so recht, wie es war, und viel lieber, als wenn der unermeßliche Schnee schnell und plötzlich in Wasser verwandelt worden wäre. Dann ging ich wieder in die Stube hinauf, die sie mir viel zu viel geheizt hatten, schrieb einiges auf, und dachte nach, wie ich mir heute die Ordnung einzurichten hätte. Da sah ich auch, wie der Thomas den Fuchs zum untern Schmied hinüber führte. Nach einer Weile, da wir fertig waren, richteten wir uns zum Fortfahren. Ich tat den Regenmantel um und setzte meine breite Filzkappe auf, davon der Regen abrinnen konnte. So machte ich mich in dem Schlitten zurechte und zog das Leder sehr weit herauf. Der Thomas hatte seinen gelben Mantel um die Schultern und saß vor mir in dem Schlitten. Wir fuhren zuerst durch den Thaugrund, und es war an dem Himmel und auf der Erde so stille und einfach grau, wie des Morgens, so daß wir, als wir einmal stille hielten, den Regen durch die Nadeln fallen hören konnten. Der Fuchs hatte die Schellen an dem Schlittengeschirre nicht recht ertragen können und sich öfter daran geschreckt, deshalb tat ich sie schon, als ich nur ein paar Male mit ihm gefahren war, weg. Sie sind auch ein närrisches Klingeln, und mir war es viel lieber, wenn ich so fuhr, manchen Schrei eines Vogels, manchen Waldton zu hören, oder mich meinen Gedanken zu überlassen, als daß ich immer das Tönen in den Ohren hatte, das für die Kinder ist. Heute war es freilich nicht so ruhig, wie manchmal das stumme Fahren des Schlittens im feinen Schnee war, wie im Sande, wo auch die Hufe des Pferdes nicht wahrgenommen werden konnten; denn das Zerbrechen des zarten Eises, wenn das Tier darauf trat, machte ein immerwährendes Geräusch, daher aber das Schweigen, als wir halten mußten, weil der Thomas in dem Riemzeug etwas zurecht zu richten hatte, desto auffallender war. Und der Regen, dessen Rieseln durch die Nadeln man hören konnte, störte die Stille kaum, ja er vermehrte sie. Noch etwas anderes hörten wir später, da wir wieder hielten, was fast lieblich für die Ohren war. Die kleinen Stücke Eises, die sich an die dünnsten Zweige und an das langhaarige Moos der Bäume angehängt hatten, brachen herab, und wir gewahrten hinter uns in dem Walde an verschiedenen Stellen, die bald dort und bald da waren, das zarte Klingen und ein zitterndes Brechen, das gleich wieder stille war. Dann kamen wir aus dem Walde hinaus und fuhren durch die Gegend hin, in der die Felder liegen. Der gelbe Mantel des Thomas glänzte, als wenn er mit Öl übertüncht worden wäre; von der rauhen Decke des Pferdes hingen Silberfranzen hernieder; wie ich zufällig einmal nach meiner Filzkappe griff, weil ich sie unbequem auf dem Haupte empfand, war sie fest, und ich hatte sie wie eine Kriegshaube auf; und der Boden des Weges, der hier breiter und, weil mehr gefahren wurde, fester war, war schon so mit Eise belegt, weil das gestrige Wasser, das in den Gleisen gestanden war, auch gefroren war, daß die Hufe des Fuchses die Decke nicht mehr durchschlagen konnten, und wir unter hallenden Schlägen der Hufeisen und unter Schleudern unseres kleinen Schlittens, wenn die Fläche des Weges ein wenig schief war, fortfahren mußten.
Wir kamen zuerst zu dem Karbauer, der ein krankes Kind hatte. Von dem Hausdache hing ringsum, gleichsam ein Orgelwerk bildend, die Verzierung starrender Zapfen, die lang waren, teils herabbrachen, teils an der Spitze ein Wassertröpfchen hielten, das sie wieder länger und wieder zum Herabbrechen geneigter machte. Als ich ausstieg, bemerkte ich, daß das Überdach meines Regenmantels, das ich gewöhnlich so über mich und den Schlitten breite, daß ich mich und die Arme darunter rühren könne, in der Tat ein Dach geworden war, das fest um mich stand und beim Aussteigen ein Klingelwerk fallender Zapfen in allen Teilen des Schlittens verursachte. Der Hut des Thomas war fest, sein Mantel krachte, da er abstieg, auseinander, und jede Stange, jedes Holz, jede Schnalle, jedes Teilchen des ganzen Schlittens, wie wir ihn jetzt so ansahen, war in Eis, wie in durchsichtigen, flüssigen Zucker, gehüllt, selbst in den Mähnen, wie tausend bleiche Perlen, hingen die gefrornen Tropfen des Wassers, und zuletzt war es um die Hufhaare des Fuchses wie silberne Borden geheftet.
Ich ging in das Haus. Der Mantel wurde auf den Schragen gehängt, und wie ich die Filzkappe auf den Tisch des Vorhauses legte, war sie wie ein schimmerndes Becken anzuschauen.
Als wir wieder fortfahren wollten, zerschlugen wir das Eis auf unsern Hüten, auf unsern Kleidern, an dem Leder und den Teilen des Schlittens, an dem Riemzeug des Geschirres, und zerrieben es an den Haaren der Mähne und der Hufe des Fuchses. Die Leute des Karbauers halfen uns hiebei. Das Kind war schon schier ganz gesund. Unter dem Obstbaumwalde des Karhauses, den der Bauer sehr liebt und schätzt, und der hinter dem Hause anhebt, lagen unzählige kleine schwarze Zweige auf dem weißen Schnee, und jeder schwarze Zweig war mit einer durchsichtigen Rinde von Eis umhüllt und zeigte neben dem Glanze des Eises die kleine frischgelbe Wunde des Herabbruchs. Die braunen Knösplein der Zweige, die im künftigen Frühlinge Blüten- und Blätterbüschlein werden sollten, blickten durch das Eis hindurch. Wir setzten uns in den Schlitten. Der Regen, die graue Stille und die Einöde des Himmels dauerten fort.
Da wir in der Dubs hinüber fuhren, an der oberen Stelle, wo links das Gehänge ist und an der Schneide der lange Wald hin geht, sahen wir den Wald nicht mehr schwarz, sondern er war gleichsam bereift, wie im Winter, wenn der Schnee in die Nadeln gestreut ist und lange Kälte herrscht; aber der Reif war heute nicht so weiß wie Zucker, dergleichen er sonst ähnlich zu sein pflegt, sondern es war das dumpfe Glänzen und das gleichmäßige Schimmern an allen Orten, wenn es bei trübem Himmel überall naß ist; aber heute war es nicht von der Nässe, sondern von dem unendlichen Eise, das in den Ästen hing. Wir konnten, wenn wir etwas Aufwärts und daher langsamer fuhren, das Knistern der brechenden Zweige sogar bis zu uns herab hören, und der Wald erschien, als sei er lebendig geworden. Das blasse Leuchten des Eises auf allen Hügeln des Schnees war rings um uns herum, das Grau des Himmels war beinahe sehr licht, und der Regen dauerte stille fort, gleichmäßig fein und gleichmäßig dicht.
Wir hatten in den letzten Häusern der Dubs etwas zu tun, ich machte die Gange, da die Orte nicht weit auseinander lagen, zu Fuße, und der Fuchs wurde in den Stall getan, nachdem er wieder von dem Eise, das an ihm rasselte, befreit worden war. Der Schlitten und die Kleider des Thomas mußten ebenfalls ausgelöset werden; die meinigen aber, nämlich der Mantel und die Filzkappe, wurden nur von dem, was bei oberflächlichem Klopfen und Rütteln herabging, erleichtert, das andere aber daran gelassen, da ich doch wieder damit in dem Regen herum gehen mußte und neue Lasten auf mich lud. Ich hatte mehr Kranke, als sie sonst in dieser Jahreszeit zu sein pflegen. Sie waren aber alle ziemlich in der Nähe beisammen, und ich ging von dem einen zu dem andern. An den Zäunen, an den Strunken von Obstbäumen und an den Rändern der Dächer hing unsägliches Eis. An mehreren Planken waren die Zwischenräume verquollen, als wäre das Ganze in eine Menge eines zähen Stoffes eingehüllt worden, der dann erstarrte. Mancher Busch sah aus wie viele in einander gewundene Kerzen, oder wie lichte, wässerig glänzende Korallen.
Ich hatte dieses Ding nie so gesehen wie heute.
Die Leute schlugen manche der bis ins Unglaubliche herabgewachsenen Zapfen von den Dächern, weil sie sonst, wenn sie gar groß geworden waren, im Herabbrechen Stücke der Schindeln oder Rinnen mit sich auf die Erde nahmen. Da ich in der Dubs herum ging, wo mehrere Häuser um den schönen Platz herum stehen, den sie bilden, sah ich, wie zwei Mägde das Wasser, welches im Tragen hin und her geschwemmt haben würde, in einem Schlitten nach Hause zogen. Zu dem Brunnen, der in der Mitte des Platzes steht, und um dessen Holzgeschlacht herum schon im Winter der Schnee einen Berg gebildet hatte, mußten sie sich mit der Axt Stufen hinein hauen. Sonst gingen die Leute gar nicht aus den Häusern, und wo man doch einen sah, duckte er oben mit dem Haupte vor dem Regen in sein Gewand, und unten griff er mit den Füßen vorsichtig vorwärts, um in der unsäglichen Glätte nicht zu fallen.
Wir mußten wieder fort. Wir fuhren mit dem Fuchs, den wir wieder hatten scharf machen lassen, durch die ebenen Felder hinüber gegen das Eckstück, welches die Siller am höher stehenden Walde einfaßt, und wo mehrere Holzhäuser stehen. Wir hörten, da wir über die Felder fuhren, einen dumpfen Fall; wußten aber nicht recht, was es war. Auf dem Raine sahen wir einen Weidenbaum gleißend stehen, und seine zähen, silbernen Äste hingen herab, wie mit einem Kamme nieder gekämmt. Den Waldring, dem wir entgegen fuhren, sahen wir bereift, aber er warf glänzende Funken und stand wie geglättete Metallstellen von dem lichten, ruhigen, matten Grau des Himmels ab.
Von den Holzhausern mußten wir wieder zurück über die Felder, aber schief auf dem Wege gegen das Eidun. Die Hufe unseres Pferdes hallten auf der Decke, wie starke Steine, die gegen Metallschilde geworfen werden. Wir aßen bei dem Wirte etwas, weil wir zu spät nach Hause gekommen sein würden, dann, nachdem wir den Schlitten, das Pferd und unsere Kleider wieder frei gemacht hatten, fuhren wir wieder ab, auf dem Wege, der nach meinem Hause führte. Ich hatte nur noch in den letzteren Eidunhäusern etwas zu tun, und dann konnten wir auf dem Wege hinüber fahren, wo im Sommer die Eidunwiesen sind, im Winter aber alle die fahren und gehen, die im Waldhange und oberen Hage Geschäfte haben. Von da konnten wir gegen den Fahrweg einlenken, der durch den Thaugrund und nach Hause führt. Da wir uns auf den Wiesen befanden, über deren Ebene wir jetzt freilich klafterhoch erhoben fuhren, hörten wir wieder denselben dumpfen Fall, wie heute schon einmal, aber wir erkannten ihn wieder nicht, und wußten auch nicht einmal ganz genau, woher wir ihn gehört hatten. Wir waren sehr froh, einmal nach Hause zu kommen; denn der Regen und das Feuchte, das in unserm ganzen Körper steckte, tat uns recht unwohl, auch war die Glätte unangenehm, die allenthalben unnatürlich über Flur und Feld gebreitet war und den Fuß, wenn man ausstieg, zwang, recht vorsichtig auf die Erde zu greifen, woher man, wenn man auch nicht gar viel und gar weit ging, unglaublich ermüdet wurde.
Da wir endlich gegen den Thaugrund kamen und der Wald, der von der Höhe herüber zieht, anfing, gegen unsern Weg herüber zu langen, hörten wir plötzlich in dem Schwarzholze, das auf dem schön emporragenden Felsen steht, ein Geräusch, das sehr seltsam war, und das keiner von uns je vernommen hatte – es war, als ob viele Tausende oder gar Millionen von Glasstangen durcheinander rasselten und in diesem Gewirre fort in die Entfernung zögen. Das Schwarzholz war doch zu weit zu unserer Rechten entfernt, als daß wir den Schall recht klar hätten erkennen können, und in der Stille, die in dem Himmel und auf der Gegend war, ist er uns recht sonderbar erschienen. Wir fuhren noch eine Strecke fort, ehe wir den Fuchs aufhalten konnten, der im Nachhauserennen begriffen war und auch schon trachten mochte, aus diesem Tage in den Stall zu kommen. Wir hielten endlich und hörten in den Lüften gleichsam ein unbestimmtes Rauschen, sonst aber nichts. Das Rauschen hatte jedoch keine Ähnlichkeit mit dem fernen Getöse, das wir eben durch die Hufschläge unsers Pferdes hindurch gehört hatten. Wir fuhren wieder fort und näherten uns dem Walde des Thaugrundes immer mehr, und sahen endlich schon die dunkle Öffnung, wo der Weg in das Gehölze hinein geht. Wenn es auch noch früh am Nachmittage war, wenn auch der graue Himmel so licht schien, daß es war, als müßte man den Schimmer der Sonne durchsinken sehen, so war es doch ein Winternachmittag, und es war so trübe, daß sich schon die weißen Gefilde vor uns zu entfärben begannen und in dem Holze Dämmerung zu herrschen schien. Es mußte aber doch nur scheinbar sein, indem der Glanz des Schnees gegen das Dunkel der hinter einander stehenden Stämme abstach.
Als wir an die Stelle kamen, wo wir unter die Wölbung des Waldes hinein fahren sollten, blieb der Thomas stehen. Wir sahen vor uns eine sehr schlanke Fichte zu einem Reife gekrümmt stehen und einen Bogen über unsere Straße bildend, wie man sie einziehenden Kaisern zu machen pflegt. Es war unsäglich, welche Pracht und Last des Eises von den Bäumen hing. Wie Leuchter, von denen unzählige umgekehrte Kerzen in unerhörten Größen ragten, standen die Nadelbäume. Die Kerzen schimmerten alle von Silber, die Leuchter waren selber silbern, und standen nicht überall gerade, sondern manche waren nach verschiedenen Richtungen geneigt. Das Rauschen, welches wir früher in den Lüften gehört hatten, war uns jetzt bekannt; es war nicht in den Lüften; jetzt war es bei uns. In der ganzen Tiefe des Waldes herrschte es ununterbrochen fort, wie die Zweige und Äste krachten und auf die Erde fielen. Es war um so fürchterlicher, da alles unbeweglich stand; von dem ganzen Geglitzer und Geglänze rührte sich kein Zweig und keine Nadel, außer wenn man nach einer Weile wieder auf einen gebogenen Baum sah, daß er von den ziehenden Zapfen niederer stand. Wir harreten und schauten hin – man weiß nicht, war es Bewunderung oder war es Furcht, in das Ding hinein zu fahren. Unser Pferd mochte die Empfindungen in einer Ähnlichkeit teilen, denn das arme Tier schob, die Füße sachte anziehend, den Schlitten in mehreren Rucken etwas zurück.
Wie wir noch da standen und schauten – wir hatten noch kein Wort geredet – hörten wir wieder den Fall, den wir heute schon zweimal vernommen hatten. Jetzt war er uns aber völlig bekannt. Ein helles Krachen, gleichsam wie ein Schrei, ging vorher, dann folgte ein kurzes Wehen, Sausen oder Streifen, und dann der dumpfe, dröhnende Fall, mit dem ein mächtiger Stamm auf der Erde lag. Der Knall ging wie ein Brausen durch den Wald und durch die Dichte der dämpfenden Zweige; es war auch noch ein Klingeln und Geschimmer, als ob unendliches Glas durcheinander geschoben und gerüttelt würde – dann war es wieder wie vorher, die Stämme standen und ragten durch einander, nichts regte sich, und das still stehende Rauschen dauerte fort. Es war merkwürdig, wenn ganz in unserer Nähe ein Ast oder Zweig oder ein Stück Eis fiel; man sah nicht, woher es kam, man sah nur schnell das Herniederblitzen, hörte etwa das Aufschlagen, hatte nicht das Emporschnellen des verlassenen und erleichterten Zweiges gesehen, und das Starren, wie früher, dauerte fort.
Es wurde uns begreiflich, daß wir in den Wald nicht hineinfahren konnten. Es mochte irgendwo schon über den Weg ein Baum mit all seinem Geäste liegen, über den er nicht hinüber könnten, und der nicht zu umgehen war, weil die Bäume dicht stehen, ihre Nadeln vermischen und der Schnee bis in das Geäste und Geflechte des Niedersatzes ragte. Wenn wir dann umkehrten und auf dem Wege, auf dem wir gekommen waren, zurück wollten, und da sich etwa auch unterdessen ein Baum herüber legt hätte, so wären wir mitten darinnen gewesen. Der Regen dauerte unablässig fort, wir selber waren schon wieder eingehüllt, daß wir uns nicht regen konnten, ohne die Decke zu zerbrechen, der Schlitten war schwerfällig und verglaste, und der Fuchs trug seine Lasten – wenn nirgends etwas in den Bäumen um eine Unze an Gewicht gewann, so mochte es fallen, ja die Stämme selber mochten brechen, die Spitzen der Zapfen, wie Keile, mochten nieder fahren, wir sahen ohnedem auf unserm Wege, der vor uns lag, viele zerstreut, und während wir standen, waren in der Ferne wieder dampfe Schläge zu vernehmen gewesen. Wie wir umschauten, woher wir gekommen, war auf den ganzen Feldern und in der Gegend kein Mensch und kein lebendiges Wesen zu sehen. Nur ich mit dem Thomas und mit dem Fuchse waren allein in der freien Natur.
Ich sagte dem Thomas, daß wir umkehren müßten. Wir stiegen aus, schüttelten unsere Kleider ab, so gut es möglich war, und befreiten die Haare des Fuchses von dem anhangenden Eise, von dem es uns vorkam, als wachse es jetzt viel schneller an als am Vormittage, war es nun, daß wir damals die Erscheinung beobachteten und im Hinschauen darauf ihr Fortgang uns langsamer vorkam, als Nachmittag, wo wir andere Dinge zu tun hatten und nach einer Weile erst sahen, wie das Eis sich wieder gehäuft hatte – oder war es kälter und der Regen dichter geworden. Wir wußten es nicht. Der Fuchs und der Schlitten wurde sodann von dem Thomas umgekehrt, und wir fuhren, so schnell wir konnten, gegen die uns zunächst gerichteten Eidunhäuser zurück. Es war damals am oberen Ende, wo der Bühl sacht beginnt, noch das Wirtshaus – der Burmann hat es heuer gekauft und treibt bloß Feldwirtschaft – dorthin fuhren wir über den Schnee, der jetzt trug, ohne Weg, in der geradesten Richtung, die wir einschlagen konnten. Ich bat den Wirt, daß er mir eine Stelle in seinem Stalle für meinen Fuchs zurecht räumen möchte. Er tat es, obwohl er ein Rind hinüber auf einen Platz seines Stalles hängen mußte, wo sonst nur Stroh und einstweil Futter lag, das man an dem Tage gebrauchen wollte. Den Schlitten taten wir in die Wagenlaube. Als wir das untergebracht und uns wieder von der angewachsenen Last befreit hatten, nahm ich einiges aus dem Schlitten, was ich brauchte, und sagte, ich werde nun zu Fuße den Weg nach Hause antreten; denn ich müsse in der Nacht in meinem Hause sein, weil manches zu bereiten ist, das ich morgen bedürfe, und weil ich morgen einen andern Weg einzuschlagen hätte, da ich die Kranken in dem oberen Lande besuchen müßte, die mich heute nicht gesehen hatten. – Den Thaugrund könne ich umgehen, ich wolle durch das Gebühl, dann durch die Wiesen des Meierbacher links hinauf, sodann durch die kleinen Erlenbüsche, die gefahrlos sind, hinüber gegen die Hagweiden und von dort gegen mein Haus hinunter, das in dem Tale steht.
Als ich das so gesagt hatte, wollte mein Knecht Thomas nicht zugeben, daß ich allein gehe; denn der Weg, den ich beschrieben hatte, wäre hüglig und ging an Höhen von Wiesen hinauf, wo gewiß überhängende Schneelehnen sind, und wo in dem glatten Eise das Klimmen und Steigen von großer Gefahr sein möchte. Er sagte, er wolle mit mir gehen, daß wir einander an den Meierbacher Wiesen emporhelfen, daß wir einander beistehen und uns durch das Geerle hinüberreichen möchten. Unsere Fahrangelegenheit konnten wir bei dem Wirte da lassen, er würde ihm schon sagen, wie der Fuchs zu füttern und zu pflegen sei. Morgen, wenn sich das Wetter geändert hätte, würde er um den Fuchs herüber gehen, und zu meiner Fahrt, wenn ich zeitlich fort wollte, könnte ich die Pferde des Rothbergerwirtes nehmen, um die ich den Gottlieb oder jemanden hinab schicken möge, wenn ja sonst Gott einen Tag sende, an dem ein Mensch unter den freien Himmel heraus zu gehen sich wage.
Ich sah das alles ein, was mein Knecht Thomas sagte, und da ich mich auch nicht ganz genau erinnerte – man schaut das nicht so genau an – ob denn wirklich überall da, wo ich zu gehen vor hatte, keine Bäume stünden, oder ob ich nicht einen viel weiteren Umweg zu machen oder gar wieder zurück zu gehen hätte, wenn ich nicht vordringen könnte; so gestattete ich ihm, daß er mit gehe, damit wir unser zwei sind und die Sache mit mehr Kräften beherrschten.
Ich habe in meinem Schlitten immer Steigeisen eingepackt, weil ich oft aussteigen und über manche Hügel hinauf, die in unserem Lande sind und steile Hänge haben, zu Kranken gehen muß, wo ich, wenn Glatteis herrscht, gar nicht oder mit Gefahr und Mühe auf den Wegen, die niemand pflegt, oder die verschneit und vereiset sind, hinauf kommen könnte. Weil es aber auch leicht möglich ist, daß etwas bricht, so führe ich immer zwei Paare mit, daß ich in keine Ungelegenheit komme. Heute hatte ich sie nicht gebraucht, weil ich immer an ebenen Stellen zu gehen hatte, und weil ich die Füße nicht an immer dauernde Unterstützung gewöhnen will. Ich suchte die Steigeisen aus dem Schlitten heraus und gab dem Thomas ein Paar. Dann steckte ich aus den Fächern des Schlittens die Dinge und Herrichtungen zu mir, die ich morgen brauchen sollte. An dem Gestelle des Schlittens oberhalb der Kufe dem Korbe entlang sind Bergstöcke angeschnallt, die eine sehr starke Eisenspitze haben und weiter Aufwärts einen eisernen Haken, um sich damit einzuhaken und anzuhängen. Am obersten Ende des Holzes sind sie mit einem Knaufe versehen, daß sie nicht so leicht durch die Hand gleiten. Weil ich aus Vorsicht auch immer zwei solche Stöcke bei mir habe, so gab ich dem Thomas einen, nachdem er sie abgeschnallt hatte, und einen behielt ich mir. So gingen wir dann, ohne uns noch aufzuhalten, sogleich fort, weil an solchen Wintertagen die Nacht schnell einbricht und dann sehr finster ist. Der Thomas hatte darum auch die Blendlaterne aus dem Schlitten genommen und hatte sich mit Feuerzeug versehen.
Auf dem offenen Felde, ehe wir wieder in die Nähe des Thaugrundes kamen, gingen wir ohne Steigeisen bloß mit Hülfe der Stöcke fort, was sehr beschwerlich war. Als wir in die Nähe des Waldes kamen und uns das fürchterliche Rauschen wieder empfing, beugten wir links ab gegen die Wiesen des Meierbacher hin, die eine Lichtung durch den Wald bilden, und die uns den Weg darstellen sollten, auf dem wir nach Hause gelangen könnten. Wir erreichten die Wiesen, das will sagen, wir erkannten, daß wir uns auf dem Schnee über ihrer Grenze befanden, weil die Rinde nun sanft abwärts zu gehen begann, wo unten der Bach sein sollte, über dem aber zwei Klafter hoher Schnee, oder noch höherer, stand. Wir wagten, da der Grund nicht zerrissen ist und die Decke mit ihrem Glänzen ein gleichmäßiges Abgehen zeigte, das Hinabfahren mit unseren Bergstöcken. Es gelang gut. Wir hätten wohl mittelst der Steigeisen lange gebraucht hinabzukommen, aber so gelangten wir in einem Augenblicke hinunter, daß die Luft an unseren Angesichtern und durch unsere Haare sauste. Wirklich glaubten wir, da wir wieder aufgestanden waren, es habe sich ein kleines Windchen gehoben, aber es war nur unsere Bewegung gewesen, und ringsum war es so ruhig, wie den ganzen Tag. Wir legten nun in dem Grunde unsere Steigeisen an, um über die Höhe und den bedeutenden Bühel empor zu kommen, in denen sich die Wiese hinüber gegen die Erlengebüsche legt, auf die wir hinaus gelangen wollten. Es ist gut, daß ich aus Vorsicht die Spitzen der Steigeisen immer zuschleifen und schärfen lasse; denn wir gingen über den Bühel, der wie eine ungeheure gläserne Spiegelwalze vor uns lag, so gerade hinauf, als würden wir mit jedem Tritte an die Glätte angeheftet. Als wir oben waren und an dem Rande des Geerles standen, wo man ziemlich weit herum sieht, meinten wir, es dämmere bereits; denn der Eisglanz hatte da hinab, wo wir herauf gekommen waren, eine Farbe wie Zinn, und wo die Schneewehen sich überwölbten und Rinnen und Löcher bildeten, saß es wie grauliche Schatten darinnen; aber die Ursache, daß wir so trüb sahen, mußte der Tag sein, der durch die weißliche, feste Decke des Himmels dieses seltsame, dämmerige Licht warf. Wir sahen auf mehrere Wälder, die jenseits dieser Höhe herum ziehen: sie waren grau und schwarz gegen den Himmel und den Schnee, und die Lebendigkeit in ihnen, das gedämpfte Rauschen, war fast hörbar – aber deutlich zu vernehmen war mancher Fall, und dann das Brausen, das darauf durch die Glieder der Bergzüge ging.
Wir hielten uns nicht lange an diesem Platze auf, sondern suchten in die Büsche der Erlen einzudringen und durch sie hindurch zu kommen. Die Steigeisen hatten wir weggetan und trugen sie über unsern Rücken herab hängend. Es war schwer, durch die Zweige, die dicht aus dem Schnee nach allen Richtungen ragten, zu kommen. Sie hielten uns die starren Ausläufe wie unzählige stählerne Stangen und Spieße entgegen, die in unsere Gewänder und Füße bohrten und uns verletzt haben würden. Aber wir gebrauchten unsere Bergstöcke dazu, daß wir mit ihnen vor uns in das Gezweige schlugen und Eis und Holz so weit zerschlugen und weich machten, daß wir mit Arbeit und gegenseitiger Hülfe durch gelangen konnten. Es dauerte aber lange.
Da wir endlich heraus waren und an den Hagweiden standen, wo wir hinunter in das Tal sahen, in dem mein Haus ist, dämmerte es wirklich, aber wir waren schon nahe genug, und besorgten nichts mehr. Durch die allgemeine dicke, weißgraue Luft sahen wir mein Haus, und ein gerader bläulicher Rauch stieg aus demselben empor, wahrscheinlich von dem Feuer kommend, an dem Maria, die Haushälterin, unser Mahl in Bereitschaft richtete. Wir legten hier wieder die Steigeisen an und gingen langsam hinunter, bis wir auf ebenem Boden waren, wo wir sie wieder weg taten.
Vor den Türen der Häuser, die in der Nähe des meinigen sind, standen Gruppen von Menschen und schauten den Himmel an.
„Ach, Herr Doktor,“ riefen sie, „ach, Herr Doktor, wo kommt Ihr denn an diesem fürchterlichen Tage her?“
„Ich komme von der Dubs und von den Eidunhäusern,“ sagte ich, „mein Pferd und den Schlitten ließ ich zurück, und bin über die Meierbacher Wiesen und die Hagweiden gekommen, weil ich nicht mehr durch den Wald konnte.“
Ich blieb ein wenig bei den Leuten stehen. Wirklich war der Tag ein furchtbarer. Das Rauschen der Wälder war von ringsum bereits bis hierher zu hören, dazwischen tönte der Fall von Bäumen, und folgte immer dichter auf einander; ja sogar von dem hohen obern Walde her, wo man gar nicht wegen der Dicke des Nebels hin sehen konnte, konnte man das Krachen und Stürzen vernehmen.
Der Himmel war immer weißlich, wie den ganzen Tag, ja sein Schimmer schien jetzt gegen Abend noch lichter zu werden; die Luft stand gänzlich unbewegt, und der feine Regen fiel gerade herunter.
„Gott genade dem Menschen, der jetzt im Freien ist, oder gar im Walde“, sagte einer aus den Umstehenden.
„Er wird sich wohl gerettet haben“, sagte ein anderer; „denn heute bleibt niemand auf einem Wege.“
Ich und der Thomas trugen starke Lasten, die schier nicht mehr zu erhalten waren, deswegen nahmen wir Abschied von den Leuten und gingen unserm Hause zu. Jeder Baum hatte einen schwarzen Fleck um sich, weil eine Menge Zweige herab gerissen war, als hätte sie ein starker Hagelschlag getroffen. Mein hölzernes Gitter, mit dem ich den Hof von dem Garten, der noch nicht fertig war, abschließe, stand silbern da, wie vor dem Altare einer Kirche; ein Pflaumenbaum daneben, der noch von dem alten Allerb herrührte, war geknickt. Die Fichte, bei welcher mein Sommerbänklein steht, hatten sie dadurch vor Schaden zu verwahren gesucht, daß sie mit Stangen, so weit sie reichen konnten, das Eis herabschlugen – und wie der Wipfel sich gar schier zu neigen schien, ist der andere Knecht, Kajetan, hinauf gestiegen, hat vorsichtig oberhalb sich herab geschlagen und hat dann an die obersten Äste zwei Wiesbaumseile gebunden, die er herab hängen ließ, und an denen er von Zeit zu Zeit rüttelte. Sie wußten, daß mir der Baum lieb war, und er ist auch sehr schön, und mit seinen grünen Zweigen so bebuscht, daß sich eine ungeheure Last von Eis daran gehängt und ihn zerspellt oder seine Äste zerrissen hätte. Ich ging in meine Stube, die gut gewärmt war, legte alle Dinge, die ich aus dem Schlitten zu mir gesteckt hatte, auf den Tisch, und tat dann die Kleider weg, von denen sie unten das Eis herab schlugen und sie dann in die Küchenstube aufhängen mußten; denn sie waren sehr feucht. Als ich mich anders angekleidet hatte, erfuhr ich, daß der Gottlieb zu dem Walde des Thaugrundes hinab gegangen und noch immer nicht zurückgekehrt sei, weil er wisse, daß ich durch den Thaugrund mit meinem Schlitten daher kommen müsse. Ich sagte dem Kajetan, daß er ihn holen solle, daß er sich noch jemand mitnehme, wenn er einen finden könne, der ihn begleite, daß sie eine Laterne und Eisen an die Füße und Stöcke in die Hand nehmen sollen. Sie brachten ihn später daher, und er war schier mit Panzerringen versehen, weil er nicht überall das Eis von sich hatte abwehren können.
Ich aß ein weniges von meinem aufgehobenen Mahle. Die Dämmerung war schon weit vorgerückt und die Nacht bereits herein gebrochen. Ich konnte jetzt das verworrene Getöse sogar in meine Stube her ein hören, und meine Leute gingen voll Angst unten in dem Hause herum.
Nach einer Weile kam der Thomas, der ebenfalls gegessen und andere Kleider angetan hatte, zu mir herein und sagte, daß sich die Leute der Nachbarhäuser versammeln und in großer Bestürzung seien. Ich tat einen starken Rock um und ging mittelst eines Stockes über das Eis zu den Häusern hinüber. Es war bereits ganz finster geworden, nur das Eis auf der Erde gab einen zweifelhaften Schein und ein Schneelicht von sich. Den Regen konnte man an dem Angesichte spüren, um das es feucht war, und ich spürte ihn auch an der Hand, mit welcher ich den Bergstock einsetzte. Das Getöse hatte sich in der Finsternis vermehrt, es war rings herum an Orten, wo jetzt kein Auge hindringen konnte, wie das Rauschen entfernter Wasserfälle, – das Brechen wurde auch immer deutlicher, als ob ein starkes Heer oder eine geschreilose Schlacht im Anzuge wäre. Ich sah die Leute, als ich näher gegen die Häuser kam, stehen, aber ich sah die schwarzen Gruppen derselben von den Häusern entfernt mitten im Schnee, nicht etwa vor den Türen oder an der Wand.
„Ach Doktor helft, ach Doktor helft“, riefen einige, da sie mich kommen sahen und mich an meinem Gang erkannten.
„Ich kann euch nicht helfen, Gott ist überall groß und wunderbar, er wird helfen und retten“, sagte ich, indem ich zu ihnen hinzu trat.
Wir standen eine Weile bei einander und horchten auf die Töne. Später vernahm ich aus ihren Gesprächen, daß sie sich fürchteten, daß bei der Nacht die Häuser eingedrückt werden könnten. Ich sagte ihnen, daß sich in den Bäumen, insbesondere bei uns, wo die Nadelbäume so vorherrschend sind, in jedem Zweige, zwischen den kleinsten Reisern und Nadeln das unsäglich herunter rinnende Wasser sammle, in dem seltsamen Froste, der herrsche, gefriere und durch stetes nachhallendes Wachsen an den Ästen ziehe, Nadeln, Reiser, Zweige, Äste mit herab nehme, und endlich Bäume biege und breche; aber von dem Dache, auf welchem die glatte Schneedecke liege, rinne das Wasser fast alles ab, um so mehr, da die Rinde des Eises glatt sei und das Rinnen befördere. Sie möchten nur durch Haken Stücke des Eises herab reißen, und da würden sie sehen, zu welch geringer Dicke die Rinde auf der schiefen Fläche anzuwachsen im Stande gewesen sei. An den Bäumen ziehen unendlich viele Hände gleichsam bei unendlich vielen Haaren und Armen hernieder; bei den Häusern schiebe alles gegen den Rand, wo es in Zapfen niederhänge, die ohnmächtig sind, oder losbrechen, oder herab geschlagen werden können. Ich tröstete sie hiedurch, und sie begriffen die Sache, die sie nur verwirrt hatte, weil nie der gleichen oder nicht in solcher Gewalt und Stärke erlebt worden war.
Ich ging dann wieder nach Hause. Ich selber war nicht so ruhig, ich zitterte innerlich; denn was sollte das werden, wenn der Regen noch immer so fort dauerte und das Donnern der armen Gewächse in so rascher Folge zunahm, wie es jetzt, wo schier alles am Äußersten war, geschah. Die Lasten hatten sich zusammengelegt; ein Lot, ein Quentchen, ein Tropfen konnte den hundertjährigen Baum stürzen. Ich zündete in meiner Stube Lichter an, und wollte nicht schlafen. Der Bube Gottlieb hatte durch das lange Stehen und Warten an dem Thaugrunde ein leichtes Fieber bekommen. Ich hatte ihn untersucht, und schickte ihm etwas hinunter.
Nach einer Stunde kam der Thomas und sagte, daß die Leute zusammen gekommen seien und beten; das Getöse sei furchtbar. Ich erwiderte ihm, es müsse sich bald ändern, und er entfernte sich wieder.
Ich ging in dem Zimmer, in das der Lärmen, wie tosende Meereswogen, drang, auf und nieder, und da ich mich später auf das lederne Sitzbette, das da stand, ein wenig niedergelegt hatte, schlief ich aus Müdigkeit doch ein.
Als ich wieder erwachte, hörte ich ein Sausen oberhalb meinem Dache, das ich mir nicht gleich zu erklären vermochte. Als ich aber aufstand, mich ermannte, an das Fenster trat und einen Flügel öffnete, erkannte ich, daß es Wind sei, ja, daß ein Sturm durch die Lüfte dahin gehe. Ich wollte mich überzeugen, ob es noch regne, und ob der Wind ein kalter oder warmer sei. Ich nahm einen Mantel um, und da ich durch das vordere Zimmer ging, sah ich seitwärts Licht durch die Tür des Gemaches herausfallen, in welchem Thomas schläft. Er ist nämlich in meiner Nähe, damit ich ihn mit der Glocke rufen könne, wenn ich etwas brauche, oder falls mir etwas zustieße. Ich ging in das Gemach hinein und sah, daß er an dem Tische sitze. Er hatte sich gar nicht nieder gelegt, weil er sich, wie er mir gestand, zu sehr fürchtete. Ich sagte ihm, daß ich hinunter gehe, um das Wetter zu prüfen. Er stand gleich auf, nahm seine Lampe, und ging hinter mir die Treppe hinab. Als wir unten im Vorhause angekommen waren, stellte ich mein Licht in die Nische der Stiege und er seine Lampe dazu. Dann sperrte ich die Tür auf, die in den Hof hinaus führt, und als wir aus den kalten Gängen hinaus traten, schlug uns draußen eine warme, weiche Luft entgegen. Der ungewöhnliche Stand der Dinge, der den ganzen Tag gedauert hatte, hatte sich gelöset. Die Wärme, welche von der Mittagseite her kam und bis jetzt nur in den oberen Teilen geherrscht hatte, war nun auch, wie es meist geschieht, in die untern herab gesunken, und der Luftzug, der gewiß oben schon gewesen war, hatte sich herabgedrückt und war in völligen Sturm Übergegangen. Auch am Himmel war es, so viel ich sehen konnte, anders geworden. Die einzelne graue Farbe war unterbrochen; denn ich sah dunkle und schwarze Stücke hie und da zerstreut. Der Regen war nicht mehr so dicht, schlug aber in weiter zerstreuten und stärkeren Tropfen an unser Gesicht. Als ich so stand, näherten sich mir einige Menschen, die in der Nähe meines Hauses gewesen sein mußten. Mein Hof ist nämlich nicht so, wie es gewöhnlich zu sein pflegt, und damals war er noch weniger verwahrt als jetzt. Das Mauerwerk meines Hauses ist nämlich von zwei Seiten ins Rechteck gestellt, und das sind die zwei Seiten des Hofes. Die dritte war damals mit einer Planke versehen, hinter der der Garten werden sollte, in den man durch ein hölzernes Gitter hinein ging. Die vierte war die Einfahrt, damals auch Planke, nicht einmal gut gefügt, und mit einem hölzernen Gittertore versehen, das meistens offen stand. In der Mitte des Hofes sollte ein Brunnen werden, der aber damals noch gar nicht angefangen war. Es kam daher leicht an, daß Menschen zu mir in meinem Hofe herzu treten konnten. Sie waren im Freien gestanden und hatten in großer Angst den Zustand der Dinge betrachten wollen. Als sie das Licht in den Fenstern meiner Stube verschwinden sahen und gleich darauf bemerkten, daß es an den Fenstern des Stiegenhauses herunter gehe, dachten sie, daß ich in den Hof kommen würde, und gingen näher herzu. Sie fürchteten erst rechte Verheerungen und unbekannte Schrecken, da nun der Sturm auch noch dazu gekommen sei. Ich sagte ihnen aber, daß dies gut ist, und daß nun das Ärgste bereits hinter uns liege. Es war zu erwarten, daß die Kälte, die nur unten, nicht aber oben war, bald verschwinden würde. Es könne nun, da der Wind so warm sei, kein neues Eis mehr entstehen, ja das alte müsse weniger werden. Der Wind, wie sie meinten und fürchteten, könne auch nicht mehr Bäume stürzen, als in der Windstille gefallen sind; denn als er sich hob, sei er gewiß nicht so stark gewesen, daß er zu der Wucht, mit der mancher Stamm schon beladen gewesen war, so viel hinzu gegeben hätte, daß der Stamm gebrochen wäre, wohl aber sei er gewiß schon stark genug gewesen, um das Wasser, das locker in den Nadeln geschwebt hatte, und die Eisstücke, die nur mit einem schwachen Halt befestigt gewesen waren, herab zu schütteln. Der nächste, stärkere Stoß habe schon einen erleichterten Baum gefunden und habe ihn noch mehr erleichtert. So sei die Windstille, in der sich alles heimlich sammeln und aufladen konnte, das Furchtbare, und der Sturm, der das Zusammengeladene erschütterte, die Erlösung gewesen. Und wenn auch mancher Baum durch den Wind zum Falle gebracht wurde, so wurden doch gewiß weit mehrere durch ihn gerettet, und der schon im Äußersten stehende Stamm wäre auch in der Windstille, nur um eine kleine Zeit später, gefallen. Und nicht bloß herab geschüttelt habe der Wind das Eis, sondern er habe es auch durch seinen warmen Hauch zuerst in den zarteren Geweben, dann in den stärkeren zerfressen, und habe das dadurch entstandene und auch das vom Himmel gefallene Wasser nicht in den Zweigen gelassen, wie es eine bloß warme, aber stille Luft getan hätte. Und in der Tat, obwohl wir durch das Sausen des Sturmes hindurch das frühere Rauschen der Wälder nicht hören konnten, so waren doch die dumpfen Fälle, die wir allerdings noch vernahmen, viel seltener geworden.
Nach einer Weile, in welcher der Wind immer heftiger und, wie wir meinten, auch immer wärmer geworden war, wünschten wir uns eine gute Nacht, und gingen nach Hause. Ich begab mich auf meine Stube, entkleidete mich, legte mich in das Bett, und schlief recht fest bis an den Morgen, da schon der helle Tag an dem Himmel stand.
Als ich erwacht war, stand ich auf, legte die Kleider an, die ich am Morgen gerne habe, und ging an die Fenster. Der Sturm hatte sich noch gesteigert. Ein weißer Schaum jagte an dem Himmel dahin. Der blaue Rauch, der aus der Hütte des Klum herausging, zerflatterte, wie ein zerrissener Schleier. Wo sich ein Stück einer schwarzen Wolke hinter einem Walde hervorragend sehen ließ, wälzte es sich am Himmel hin, und war gleich wieder nicht sichtbar. Es schien, als sollte jeder Dunst verjagt werden und sogleich das reine Blau zum Vorschein kommen; allein es quoll der weiße Qualm immer wieder heraus, als würde er in der Tiefe des Himmels erzeugt; und braunliche und graue und rötliche Stücke jagten in ihm dahin. Die Dächer der Nachbarhütten schimmerten naß; in den Mulden des Eises, das über dem Schnee lag, stand Wasser, und wurde gekräuselt und in feinen Tropfen in die Lüfte zerspritzt; das andere nasse Eis glänzte schimmernd, als wäre die Weiße des Himmels darauf geworfen, die Wälder ragten finsterer und die schwarze Farbe des Sturmes gewinnend gegen den Himmel, und wo ein näherer Baum seine Äste im Winde wiegte, stand oft augenblicklich ein langer Blitz da und verschwand, und selbst über die ferneren Wände der Wälder lief es noch zu Zeiten wie verlorenes Geschimmer und Geglänze. In meinem Hofe war es naß, und die einzelnen, aber großen Tropfen schlugen gegen die andere Wand meines Hauses und gegen ihre Fenster; denn die meinigen waren dem Winde nicht zugekehrt und schauten gegen Sonnenaufgang. Bei der Fichte, an der mein Sommerbänklein steht, das aber jetzt wegen der großen Überhüllung des Schnees nicht zu erblicken war, sah ich, wie sie Leitern anlegten und der Kajetan hinauf kletterte, um die zwei Wiesbaumseile los zu lösen.
Die Gefahr, in welcher wir schwebten, war nun eine andere und größere als gestern, wo nur für die Wälder und Gärten ein großer Schaden zu fürchten gewesen war. Wenn das Wasser von dem außerordentlich vielen Schnee, der in dem Winter gefallen war, auf einmal los gebunden wird, so kann es unsere Felder, unsere Wiesen und unsere Häuser zerstören. Der Wind war noch wärmer, als in der vergangenen Nacht; denn ich öffnete die Fenster des Ganges, um ihn zu empfinden. Wenn einmal die dichte Eisdecke, die sich gestern wie zum Schutze auf die Erde gelegt hatte, durchfressen ist, dann wird der Schnee, das lockere Gewirre von lauter dünnen Eisnadeln, schnell in Tropfen zerfallen, die wilden Ungeheuer der Waldbäche werden aus den Tälern herausstürzen und donnernd die Felder, die Wiesen, die Flächen mit Wasser füllen; von allen Bergen werden schäumende Bänder niedergehen; das beweglich gewordene Wasser wird, wo Felsen und jähe Abhänge empor ragen, die Lawinen, welche Steine, Schnee und Bäume ballen, die Bäche dämmen und vor sich ein Meer von Wasser erzeugen.
Ich legte meine Kleider an, aß schnell mein Frühmahl und bereitete mich zu dem heutigen Tagewerke. Ich ging zu dem Knaben Gottlieb hinab, um nachzuschauen; aber er war ganz gesund und sah sehr gut aus. Ich sendete zu dem Vetter Martin, dem Wirt am Rothberge, hinunter, daß er mir heute ein Fuhrwerk leihe, denn durch den Thaugrund war der Weg durch gestürzte Bäume verlegt und konnte so bald nicht befreit werden, obwohl nun keine Gefahr mehr unter den Bäumen herrschte. Von dem Rothberge herauf war aber alles frei geblieben; denn die Buchen mit ihren zähen Ästen hatten die belasteten Zweige zwar bis auf die Erde hängen lassen, waren aber doch dem Zerbrechen widerstanden. Auf dem Wege, auf welchem wir gestern gekommen waren, konnte der Thomas nicht in das Eidun und zu dem Fuchse hinüber gelangen, weil das Eis nicht mehr trug; und ein tiefes, gefährliches Versinken in den wässerigen Schnee hätte erfolgen müssen. Er sagte, er wolle es gegen Mittag versuchen, bei den gestürzten Bäumen vorbei zu klettern und so in das Eidun zu kommen. Von den Rothberghäusern war zeitlich früh schon ein Bote herauf gekommen, der mir Nachricht von einem Kranken zu bringen hatte, und dieser hatte mir auch gesagt, daß es durch den Haidgraben und an dem Buchengehäng von dem Rothberge herauf frei geblieben war.
Während ich auf den Knecht wartete, den mir der Wirt am Rothberge mit einem Fuhrwerke senden sollte, untersuchte ich die Eisrinde des Schnees. Sie war noch nicht zerstört, aber an vielen Stellen in der Nähe meines Hauses so dünn, daß ich sie mit meiner Hand zerbrechen konnte. In muldenförmigen Gräben rann das Wasser auf der glatten Unterlage bereits sehr emsig dahin. Der Regen hatte ganz aufgehört, höchstens daß noch mancher einzelne Tropfen von dem Winde geschleudert wurde. Der Wind aber dauerte fort, er glättete das Eis, auf dem er das dünne Wasser dahin jagte, zu dem feinsten Schliffe, und lösete durch seine Weichheit unablässig alles Starre und Wassergebende auf.
Der Knecht des Wirtes am Rothberge kam, ich nahm mein Gewand gegen den Wind zusammen und setzte mich in den Schlitten. Ich habe an diesem Tage viele Dinge gesehen. Statt daß es gestern auf den Höhen und in den Wäldern gerauscht hatte, rauschte es heute in allen Tälern, statt daß es gestern an den Haaren des Fuchses nieder gezogen hatte, flatterten sie an dem heutigen Pferde in allen Winden. Wenn wir um eine Schneewehe herum biegen wollten, sprang uns aus ihr ein Guß Wasser entgegen, es raschelte in allen Gräben, und in den kleinsten, unbedeutendsten Rinnen rieselte und brodelte es. Die Siller, sonst das schöne, freundliche Wasser, brauste aus dem Walde heraus, hatte die fremdartig milchig schäumenden Wogen des Schneewassers, und stach gegen die dunkle Höhle des Waldes ab, aus der sie hervor kam, und in der noch die gestürzten Bäume über einander und über das Wasser lagen, wie sie gestern von dem Eise gefällt worden waren. Wir konnten nicht durch den Wald fahren, und mußten durch die Hagweiden den Feldweg einschlagen, der heuer zufällig befahren war, weil die Bewohner von Haslung ihr Holz von dem Sillerbruche wegen des vielen Schnees nicht durch den Wald, sondern auf diesem Umwege nach Hause bringen mußten. Wir fuhren durch den geweichten Schnee, wir fuhren durch Wasser, daß der Schlitten beinahe schwamm, und einmal mußte das Tier von dem Knechte mit größter Vorsicht geführt werden, und ich mußte bis auf die Brust durch das Schneewasser gehen.
Gegen Abend wurde es kühler, und der Wind hatte sich beinahe gelegt.
Als ich mich zu Hause in andere Kleider gehüllt hatte und um den Thomas fragte, kam er herauf zu mir und sagte, daß er mit dem Fuchse noch glücklich nach Hause gekommen sei. Er habe die gestürzten Bäume überklettert, man sei mit Sägen mit ihm gegangen, um wenigstens die größeren Stücke von dem Wege zu bringen, und da er zurück gekommen war, sei es schon ziemlich frei gewesen. Über die kleineren Stämme und über die Äste habe er den Schlitten hinüber geleitet. Aber der Bach, der im Thaugrunde fließt, hätte ihm bald Hindernisse gemacht. Es ist zwar nicht der Bach da, aber an der Stelle, wo unter dem Schnee der Bach fließen sollte, oder eigentlich gefroren sein mag, rann vieles Wasser in einer breiten Rinne hin. Als er den Fuchs hineinleitete, wäre derselbe im Schnee versunken, der in dem Grunde des Wassers ist, daher er ihn wieder zurück zog und selber durch Hineinwaten so lange versuchte, bis er den festen Boden des heurigen Schlittenweges fand, auf welchem er dann den Fuchs und den Schlitten durchgeführt habe. Später wäre es nicht mehr möglich gewesen; denn jetzt stehe ein ganzer See von Wasser in den Niederungen des Thaugrundes.
Ähnliche Nachrichten kamen aus verschiedenen Teilen meiner Nachbarschaft; von der Ferne konnte ich keine bekommen, weil sich niemand getraute, unter diesen Umständen einen weiteren Weg zu gehen. Selbst zwei Boten, die mir von entfernten Kranken Nachricht bringen sollten, sind ausgeblieben.
So brach die Nacht herein und hüllte uns die Kenntnis aller Dinge zu, außer dem Winde, den wir über die weiße, wassergetränkte, gefahrdrohende Gegend hinsausen hörten.
Am andern Tage war blauer Himmel, nur daß einzelne Wölklein nicht schnelle, sondern gemach durch das gereinigte Blau dahin segelten. Der Wind hatte fast gänzlich aufgehört, und zog auch nicht mehr aus Mittag, sondern ganz schwach aus Untergang Auch war es kälter geworden, zwar nicht so kalt, daß es gefroren hätte, doch so, daß sich kein neues Wasser mehr erzeugte. Ich konnte auf meinen Wegen fast überall durchdringen, außer an zwei Stellen, wo das Wasser in einer solchen Tiefe von aufgelösetem und durchweichtem Schnee dahin rollte, daß es nicht möglich war, durch zu gehen oder zu fahren. An einem andern Platze, wo es zwar ruhig, aber breit und tief in der Absenkung des Tales stand, banden sie Bäume zusammen und zogen mich gleichsam auf einem Floße zu einem gefährlichen Kranken hinüber. Ich hätte die andern zwar auch gerne gesehen, aber es war doch nicht so notwendig, und morgen hoffte ich schon zu ihnen gelangen zu können.
Am nächsten Tage war es wieder schön. Es war in der Nacht so kalt gewesen, daß sich die stehenden Wässer mit einer Eisdecke überzogen hatten. Diese schmolz am Tage nicht weg, wohl aber zerbrach sie, indem die Wässer in die unterhalb befindliche Grundlage des Schnees schnell einsanken und versiegender wurden. Es war doch gestern gut gewesen, daß ich zu dem Kumberger Franz auf dem Floße hinüber gefahren bin, denn das Mittel, welches ich ihm da gelassen hatte, hatte so gut gewirkt, daß er heute viel besser war und fast die Gefahr schon überstanden hatte. Auch zu den andern zweien konnte ich schon gelangen. Man konnte zwar nicht fahren, weil es unter dem Wasser zu ungleich war, aber mit einer Stange und meinem Bergstocke, den ich daran band, konnte ich durchgehen. Die nassen Kleider wurden, nachdem ich die zweiten, die ich mit führte, im Gollwirtshause angelegt hatte, in den Schlitten gepackt.
Am nächsten Tage konnte ich auch schon wieder durch den Thaugrund in das Eidun und in die Dubs hinüber gelangen.
Es kamen nun lauter schöne Tage. Eine stetige, schwache Luft ging aus Sonnenaufgang. Nachts fror es immer, und bei Tage tauete es wieder. Die Wässer, welche sich in jenem Sturme gesammelt hatten, waren nach und nach so versiegt und versunken, daß man keine Spur von ihnen entdecken konnte, und daß man auf allen Wegen, die sonst im Winter gangbar sind, wieder zu gehen und anfangs mit Schlitten und später mit Wägen zu fahren vermochte. Eben so hatte sich die unermeßliche Menge Schnee, die wir so gefürchtet hatten, so allmählig verloren, daß wir nicht wußten, wo er hingekommen ist, als hie und da offene Stellen zum Vorscheine kamen, und endlich nur mehr in Tiefen und Schluchten und in den höheren Wäldern die weißen Flecke lagen.
In den ersten Tagen nach jenem Ereignisse mit dem Eise, als die Leute sich allgemach wieder auf entferntere Wege wagten, konnte man die Zerstörungen erst recht ermessen. An manchen Orten, wo die Bäume dicht standen und wegen Mangel an Luftzug und Licht die Stämme dünner, schlanker und schwächer waren, dann an Gebirgshängen, wo sie mageren Boden hatten, oder durch Einwirkung herrschender Winde schon früher schief standen, war die Verwüstung furchtbar. Oft lagen die Stämme wie gemähte Halme durcheinander, und von denen, die stehen geblieben waren, hatten die fallenden Äste herab geschlagen, sie gespalten oder die Rinde von ihnen gestreift und geschunden. Am meisten hatte das Nadelholz gelitten, weil es zuerst schon, namentlich, wo es dicht steht, schlankere, zerbrechlichere Schafte hat, dann weil die Zweige auch im Winter dicht bebuscht sind und dem Eise um viel mehr Anhaltsstellen gewähren, als die der anderen Bäume. Am wenigsten wurde die Buche mitgenommen, dann die Weide und Birke. Die letztere hatte nur die feinsten herabhängenden Zweige verloren, die wie Streu herum lagen; – wo ein Stamm dünne genug war, hatte er sich zu einem Reife gebogen, derlei Reifen man dann im Frühlinge viele herum stehen sehen konnte; ja noch im Sommer und selbst nach mehreren Jahren waren manche zu sehen. Allein, wie groß auch die Zerstörung war, wie bedeutend auch der Schaden war, der in den Wäldern angerichtet wurde, so war dieses in unserer Gegend weniger empfindlich, als es in andern gewesen wäre; denn da wir Holz genug hatten, ja, da eher ein Überfluß als ein Mangel daran herrschte, so konnten wir das, was wirklich zu Grunde gegangen war, leicht verschmerzen, auch mochten wir zu dem nächsten Bedürfnisse nehmen, was gefallen war, wenn man nämlich dazu gelangen konnte, und es nicht in Schlachten lag oder an unzugänglichen Felsen hing. Größer aber und eindringlicher noch mochte der Schaden an Obstbäumen sein, wo die Äste von ihnen gebrochen waren, und wo sie selber gespalten und geknickt wurden; denn Obstbäume sind ohnedem in der Gegend seltener als sonst wo, und sie brauchen auch mehr Pflege und Sorgfalt, und gedeihen langsamer, als es selbst nur wenige Stunden von uns der Fall ist, in der ebeneren Lage draußen, in Tunberg, in Rohren, in Gurfeld, und selbst in Pirling, das näher an uns ist und an unseren Waldverhältnissen schon Teil nimmt.
Von den Gruppen von Bäumen, die in meiner Wiese und in der Nachbarschaft herum stehen, und die ich so liebe, haben mehrere gelitten. Einige sind geknickt, haben ihre Äste verloren, und drei Eschen sind ganz und gar umgeworfen worden.
Im Thurwalde, der vielleicht der höchste ist, den man vom Hage und vom Hange sehen kann, ist eine Lawine herabgegangen und hat das Holz genommen, daß man jetzt noch den Streifen mit freiem Auge erblicken kann.
Als einige Zeit vergangen war und die Wege an den Orten wieder frei wurden, hörte man auch von den Unglücksfällen, die sich ereignet hatten, und von wunderbaren Rettungen, die vorgekommen waren. Ein Jäger auf der jenseitigen Linie, der sich nicht hatte abhalten lassen, an dem Tage des Eises in sein Revier hinauf zu gehen, wurde von einer Menge stürzender Zapfen erschlagen, die sich am oberen Rande einer Felswand losgelöst und die weiter unten befindlichen mitgenommen hatten. Man fand ihn mitten unter diesen Eissäulen liegen, da man sich am andern Tag trotz des Sturmes und der Schneeweiche den Weg hinauf zu ihm gebahnt hatte; denn der Jägerjung wußte, wohin sein Herr gegangen war, er nahm die Hunde mit, und diese zeigten durch ihr Anschlagen die Stelle, wo er lag. Zwei Bauern, welche von dem Rothberge, wo sie übernachtet hatten, durch die Waldhäuser in die Rid hinübergehen wollten, wurden von fallenden Bäumen erschlagen. Im untern Astung ertrank ein Knabe, der nur zum Nachbar gehen wollte. Er versank in dem weichen Schnee, welcher in der Höhlung des Grundes stand, und konnte nicht mehr herauskommen. Wahrscheinlich wollte er, wie man erzählte, nur ein klein wenig von dem Wege abweichen, weil derselbe schief und mit glattem Eise belegt war, und geriet dadurch in den Schnee, der über einer weiten Grube lag, und unter den am ganzen Tage das Wasser hinein gerieselt war und ihn trügerisch unterhöhlt hatte. Ein Knecht aus den Waldhäusern des Rothbergerhanges, der im Walde war und das beginnende Rauschen und Niederfallen der Zweige nicht beachtet hatte, konnte sich, als er nicht mehr zu entrinnen wußte, nur dadurch retten, daß er sich in die Höhlung, welche zwei im Kreuze aufeinander gestürzte Bäume unter sich machten, hinein legte, wodurch er vor weiteren auf die Stelle stürzenden Bäumen gesichert war und von fallendem Eise nichts zu fürchten hatte, da es auf dem Rund der großen Stämme zerschellte oder abgeschleudert wurde. Allein das wußte er nicht, wenn ein neuer, starker Stamm auf die zwei schon daliegenden fiele, ob sie nicht aus ihrer ersten Lage weichen, tiefer nieder sinken und ihn dann zerdrücken würden. In dieser Lage brachte er einen halben Tag und die ganze Nacht zu, indem er nasse Kleider und nichts bei sich hatte, womit er sich erquicken und den Hunger stillen konnte. Erst mit Anbruch des Tages, wo der Wind sauste und er von fallendem Eise und Holze nichts mehr vernehmen konnte, wagte er sich hervor und ging, teilweise die Eisrinde schon durchbrechend und tief in den Schnee einsinkend, zum nächsten Wege, von dem er nicht weit ab war, und gelangte auf demselben nach Hause.
Auch den Josikrämer hielt man für verunglückt. Er war im Haslung am Morgen des Eistages fortgegangen, um durch den Dusterwald in die Klaus hinüber zu gehen. Allein in der Klaus ist er nicht angekommen, auch ist er in keinem der umliegenden Orte, nachdem er vom Haslung bereits drei Tage weg war, erschienen. Man meinte, in dem hohen Dusterwalde, dessen Gangweg ohnedem sehr gefährlich ist, wird er um das Leben gekommen sein. Er war aber von den letzten Höhen, die von Haslung aus noch sichtbar sind, hinabgegangen, wo das Tal gegen die wilden Wände und die vielen Felsen des Dusterwaldes hinüber läuft und sich dort an der Wildnis empor zieht, dann ist er schräg gegen die Wand gestiegen, die mit dem vielen Gesteine und den dünne stehenden Bäumen gegen Mittag schaut, und wo unten im Sommer der Bach rauscht, der aber jetzt überfroren und mit einer unergründlichen Menge von Schnee bedeckt war. Weil der Weg längs des Hanges immer fort geht und über ihn von der Höhe bald Steine rollen, bald Schnee in die Tiefe abgleitet, so hatte der Krämer seine Steigeisen angelegt; denn wenn sich auch auf der Steile nicht viel Schnee halten kann, vor dem Versinken also keine große Gefahr war, so kannte er doch den Regen, der da nieder fiel und gefror, sehr gut, und fürchtete, an mancher Schiefe des Weges auszugleiten und in den Abgrund zu fallen. Da er, ehe es Mittag wurde, bei dem Kreuzbilde vorbei ging, das vor Zeiten der fromme Söllibauer aus dem Gehänge hatte setzen lassen, hörte er bereits das Rasseln und das immer stärkere Fallen des Eises. Da er weiter ging, die Sache immer ärger wurde und zuletzt Bedenklichkeit gewann, kroch er in eine trockene Steinhöhle, die nicht weit von dem Wege war, die er wußte, und in der er sich schon manchmal vor einem Regen verborgen hatte, um auch heute das Gefahrdrohendste vorübergehen zu lassen. Weil er solche eisbildende Regen kannte, daß ihnen gewöhnlich weiches Wetter zu folgen pflegt, und weil er mit Brod und anderen Lebensmitteln versehen war, indem er gar oft sein Mittagsmahl in irgendeinem Walde hielt, so machte er sich aus dem Dinge nicht viel daraus. Als er am andern Morgen erwachte, ging ein Wasserfall über seine Steinhöhle. Der Wind, welcher von Mittag kam, hatte sich an der Wand, die ihm entgegen schaute, recht fangen können, und da die Bäume wegen dem Gefelse dünner standen, so konnte er sich auch recht auf den Schnee hinein legen und ihn mit seinem Hauche schnell und fürchterlich auflösen. Der Krämer sah, wenn er seitwärts seines Wassers am Eingange der Höhle hinüber blickte, daß allenthalben an den Gehängen weiße, schäumende, springende Bänder nieder flatterten. Hören konnte er nichts wegen dem Tosen des eigenen Wassers, das alles übertäubte. Auch sah er unten manchen Schneestaub aufschlagen von den unaufhörlich an allen Orten niedergehenden Lawinen; denn am oberen Rande der Wand geht schief eine Mulde empor, in welcher im Winter ein unendlicher Schnee zu liegen pflegt, der erstens aus dem Himmel selbst darauf fällt und dann von der noch höher liegenden schiefen, glatten Wand darauf herab rollt. Aus diesem Schnee entwickelte sich nun unsägliches Wasser, das alles über den Hang, an dem der Weg des Krämers dahin ging, nieder rann und zu der Tiefe zielte, in der sonst der Wildbach fließt, jetzt aber ein unbekannt tiefes Gebräu von Schnee und Wasser stand. An den Bäumen zerstäubte manches Stück Schnee, das oben auf dem nassen Boden sachte vorgerückt war und sich los gelöst hatte. Der Krämer blieb außer dem ersten Tage noch die zwei folgenden in der Höhle. Er hatte, um sich gegen die Kälte wehren zu können, die ihn bei seiner langen Ruhe überfiel, aus seinem Packe ein Stück grobes Tuch heraus suchen und sich daraus ein Lager und eine Decke machen müssen. In der Klaus ist er aber dann auch nicht angekommen, sondern man sah ihn am vierten Tage nach dem Eissturze nachmittags mit seinem Packe an dem Hage vorüber gehen. Er ging nach Gurfeld hinaus, um sich sein Tuch, das er gebraucht hatte, wieder zurichten zu lassen.
Spät im Sommer fand ich einmal auch die zusammengedorrten Überreste eines Rehes, das von einem Baume erschlagen worden war.
Ich werde die Herrlichkeit und Größe jenes Schauspieles niemals vergessen. Ich konnte es vielleicht nur allein ganz ermessen, weil ich immer im Freien war und es sah, während die andern in den Häusern waren und, wenn sie auch durch einen Zufall hinein gerieten, sich bloß davor fürchteten.
Ich werde es auch schon darum nicht vergessen, weil sich im Frühlinge darauf etwas angefangen hat, was mir auf ewig in dem Herzen bleiben wird. – – Ach du guter, du heiliger Gott! das werde ich gewiß nie, nie, nie vergessen können!
Es verging der Schnee so gemach, daß alles offen und grüner wurde als sonst, und daß in den tiefsten Tiefen schon die Bäche zu einer Zeit wieder rauschten, wo wir sonst noch manche weiße Inseln auf den Feldern sahen. Es wurde bald warm, und die Wässer des Schnees, die wir so gefürchtet hatten, waren nicht vorhanden. Sie waren entweder in die Erde eingesickert, oder rannen jetzt in den schönen, plätschernden Bächen durch alle Täler dahin. Die Bäume belaubten sich sehr bald, und wunderbar war es, daß es schien, als hätte ihnen die Verwundung des Winters eher Nutzen als Schaden gebracht. Sie trieben fröhliche junge Schossen, und wo einer recht verletzt war und seine Äste gebrochen ragten, und wo mehrere beisammen standen, die sehr kahl geschlagen waren, kam eine Menge feiner Zweige, und es verdichtete sich immer mehr das grüne Netz, aus dem die besten, fettesten Blätter hervor sproßten. Auch die Obstbäume blieben nicht zurück. Aus den stehen gebliebenen Zweigen kamen die dichten Büschel großer Blüten hervor; ja wo die feineren Zweige fehlten, saßen in den Augen der dicken, selbst der Stämme, Büschel von Blüten, waren sehr groß und hielten sich fest, da sie doch sonst in anderen Jahren, wenn sie auch kamen, klein blieben und wieder abfielen.
Als der erste Schnee weg ging und der spätere, den mancher Apriltag noch nieder werfen wollte, sich nicht mehr halten konnte, als die Erde schon gelockert und gegraben werden konnte, kam der Obrist in unsere Gegend. Er hatte sich schier das ganze obere Hag eigentümlich gekauft, und begann an dem Eichenhage die Grundfesten eines Hauses aufwerfen zu lassen. Es war beinahe genau die Stelle, von der ich schon früher zuweilen gedacht hatte, daß hier eine Wohnung sehr gut stehen und recht lieblich auf die Wälder herum blicken könnte. Ich kannte den Obrist nicht. Ich wußte nur – und ich hatte es bei dem Wirte im Rothberge gehört, – daß ein fremder, reicher Mann in Unterhandlung um das obere Hag sei, und daß er sich ansässig machen wolle. Später sagte man, daß der Handel geschlossen sei, und man nannte auch die Summe. Ich hielt nicht viel darauf, weil ich solche Gerüchte kannte, daß sie bei wahren Veranlassungen gewöhnlich sehr gerne über die Wahrheit hinaus gehen, und ich hatte auch keine Zeit, mich an der wahren Stelle um den Sachverhalt zu erkundigen, weil jener Winter gerade viel mehr Kranke brachte als jeder andere. Im Frühlinge hieß es, daß schon gebaut werde, daß Wägen mit Steinen fahren, daß man im Sillerwalde das Bauholz behaue, welches der Zimmermann in Sillerau schon am vorigen Herbste hatte fällen lassen, und daß man bereits die Grundfesten grabe. Ich ging eines Nachmittages, da ich Zeit hatte, hinauf, weil es von meinem Hause nicht weit ist, und weil ich ohnedem gerne dort hinübergehe, wenn ich zum Spazieren eine kleine Zeit habe. Es war wahr, ich fand eine Menge Menschen mit Ausgrabungen an dem Platze beschäftigt, wo man das Haus bauen wollte. Die meisten kannten mich und lüfteten den Hut oder grüßten auf andere Weise. Viele von ihnen hatten bei mir gearbeitet, als ich in dem nämlichen Zustande mit meinem neuen Hause war. Hier aber wurde mit viel mehr Händen und mit viel mehr Mitteln zugleich angefangen, als wollte man in sehr kurzer Zeit fertig werden. Ich sah auch schon eine Menge Baustoff herbei geschafft, und in einer hölzernen Hütte wurde vielfach an den künftigen Tür- und Fensterstöcken gemeißelt. Sogar der Garten, der neben dem künftigen Hause sein sollte, wurde schon seitwärts des Eichenhages abgesteckt. Ich sah den Baueigentümer nirgends, und als ich fragte, antwortete man mir, er sei jetzt selten gegenwärtig, er sei nur einmal gekommen, habe alles besichtigt, und habe dann den weitern Verlauf des Werkes dem Baumeister aufgetragen. Wenn es aber wärmer werde, dann werde er ganz hieher kommen, werde in einem hölzernen Hause wohnen, das er sich neben dem Eichenhage errichten lasse, und werde im Herbste schon ein paar Stoben des neuen Hauses beziehen, die zuerst fertig sein und bis dahin gehörig austrocknen werden.
Ich sah mir die Sache, wie sie hier begonnen wurde, sorgfältig an, und der Plan, wie ihn mir der Werkführer auseinandersetzte, gefiel mir sehr wohl.
Ich fragte gelegentlich auch um den Bauherrn und erfuhr, daß es ein alter Obrist sei. Weiter wußten die Leute selber nichts von ihm.
Dann ging ich wieder in meine Wohnung hinunter.

Bilder: Hinter dem Mond, Terebilovski Blues.
Westsibirischer Dorfpunk auf dem Weg zum Weltruhm, 2010 bis 2018.
Soundtrack: Ringsgwandl: Winter, aus: Staffabruck, 1993:
Bonus Track: Die nicht warm genug zu empfehlenden My Bubba, von denen wir noch hören werden,
featuring Elsa Håkansson: Visa i Molom, live vermutlich im Winter 2016/2017:
Andere Leute, die auch Bretter tragen müssen
Update zu Der den Wasserkothurn zu beseelen weiß
und Sie sollen und müssen gerettet sein!:
Wie ernst Wilhelm Busch (* 15. April 1832; † 9. Januar 1908) im eigenen Lande genommen wird, zeigt sich daran, dass seine verbreitetste Ausgabe immer noch die Sämtliche[n] Werke und eine Auswahl der Skizzen und Gemälde in zwei Bänden sind, mit den Namen Und die Moral von der Geschicht und Was beliebt ist auch erlaubt. Die sind nach überhaupt nichts geordnet, geschweige dass sie zwischen Textgattungen, Textsorten oder auch nur grob eingeteilten Schaffensperioden wie Früh-, Reife- und Spätwerk unterscheiden wollten, aber ungebrochen lieferbar, seit die Bundesrepublik Deutschland, damals noch in anderen Grenzen, existiert — nur eben ohne ausgewiesenes Erscheinungsjahr, das jedenfalls lange vor dem üblicherweise angegebenen 1982 liegen muss: herausgegeben von Rolf Hochhuth, bis heute verlagsfrisch mit dem Vorwort von Theodor Heuss ausgeliefert. Antiquariate schätzen die Ausgabe auf 1959.
Seit 2002 gibt es eine historisch-kritische Gesamtausgabe der Bildergeschichten, mit 99,99 Euro sogar recht erschwinglich — aber erstens weiß ich das aus geradezu versehentlicher persönlicher Anschauung in der Münchner Germanistik-Bibliothek, zweitens aus einem Hannoveraner Verlag, der Schlütersche Verlag und Druckerei heißt, drittens hat die kein Mensch, und viertens heißt „Bildergeschichten“: ohne die Gedichte, Gemälde und besonders schade: ohne die unterschätzte Prosa (siehe vor allem Eduards Traum, 1891; Der Schmetterling, 1895).
Fünftens, könnte man vorbringen, ist das auch schon egal, weil Wilhelm Busch für nicht mehr viel anderes bekannt ist, als dass er lustig gemeinte Paarreime erstellen konnte, die gerade noch von demnächst aussterbenden Teilnehmern auf Familienfeiern zitiert werden. — Sechstens rede ich dagegen: Das meiste davon trifft ähnlich auf Friedrich Schiller zu, mit dem Hauptunterschied: Der hat keine Bildergeschichten.
Eine Preziose wie Der harte Winter lässt sich bei sotaner Materialienlage kaum noch einordnen — egal in was; ich finde nicht, dass man für dieses Bedürfnis gleich Literaturwissenschaft praktizieren muss. Für die überhaupt irgendwie aufzutreibenden Informationen sind wir dem literarischen Befremdenführer (sic) Der rasende Leichnam, herausgegeben von Frank T. Zumbach bei Sachon, Mindelheim 1986 verpflichtet (oder auf die Biographie von Michaela Diers 2008 natürlich), mit 175 Seiten aus einem Kleinverlag der 1980er Jahre leider auch nicht geradewegs das Vademecum der letzten überlebenden Leseratten. Also: Wilhelm Busch war ab 1859 Freelancer, nein: freischaffend tätig für den Münchener Bilderbogen und die Fliegenden Blätter, ebenfalls zu München. Der harte Winter war sein erster Beitrag für „die Fliegenden“ und lässt sich — für mich, kein Literaturwissenschaftler — nicht auf den Tag genau datieren. Und wir reden vom Erscheinungstag einer gut dokumentierten Wochenzeitschrift. Schon tragisch, sowas.
Korrigiert nach der Erstveröffentlichung in den Fliegenden Blättern:
——— Wilhelm Busch:
Der harte Winter
Fliegende Blätter, Nr. 707, Seite 22, München 1859:
Es war einmal ein unvernünftig kalter Winter; da gingen zwei gute Kameraden mit einander auf das Eis zum Schlittschuhlaufen. Nun waren aber hin und wieder Löcher in das Eis geschlagen, der Fische wegen; und als die beiden Schlittschuhläufer nun im vollen Zuge waren, sintemalen der Wind auch heftig blies, versah’s der Eine, rutschte in ein Loch und traf so gewaltsam mit dem Halse vor die scharfe Eiskante, daß der Kopf auf das Eis dahinglitschte und der Rumpf in’s Wasser fiel. Der Andere, schnell entschlossen, wollte seinen Kameraden nicht im Stich lassen, zog ihn heraus, holte den Kopf und setzte ihn wieder gehörig auf, und weil es eine so barbarische Kälte in dem Winter war, so fror der Kopf auch gleich wieder fest. Da freute sich der, dem das geschah, daß die Sache noch so günstig für ihn abgelaufen war. Seine Kleider waren aber alle ganz naß geworden; darum ging er mit seinem Kameraden in ein Wirthshaus, setzte sich neben den warmen Ofen, seine Kleider zu trocknen, und ließ sich von dem Wirthe einen Bittern geben. „Prosit, Kamerad!“ sprach er und trank dem Andern zu; „auf den Schrecken können wir wohl Einen nehmen.“
Nun hatte er sich durch das kalte Bad aber doch einen starken Schnupfen geholt, daß ihm die Nase lief. Da er sie nun zwischen die Finger klemmte, sich zu schnäuzen, behielt er seinen Kopf in der Hand, denn der war in der warmen Stube wieder losgethaut.
Das war nun freilich für den armen Menschen recht fatal, und er meinte schon, daß er nun in der Welt nichts Rechtes mehr beginnen könnte; aber er wußte doch Rath zu schaffen, ging hin zu einem Bauherrn und ließ sich anstellen als Dielenträger, und war das eine gar schöne passende Arbeit für ihn, weil ihm dabei der Kopf niemals im Wege saß, wie vielen andern Leuten, die auch Bretter tragen müssen.
Soundtrack: Johnny Horton: North to Alaska, abgespeckte Frühversion 1959:
Liliensamm(e)t
Update zu Deine so oft entweihte Frühlingsfeier:
Das mussten wir in der neuten Klasse lesen, als kopiertes Handout, auf das nicht mehr als dieser eine Absatz passte. Später und auf eigene Fachbuchrechnung konnte man in der einzigen halbwegs ernstzunehmenden Gesamtausgabe von Wilhelm Hauff, in denen noch etwas anderes als die angeblich „Sämtlichen“ Märchen steht, in den satirischen Schriften ausführlich lernen, was Heinrich Clauren für ein Schädling am deutschen Literaturschaffen ist.
Der Name Heinrich Claurens hat sich in unseren neuntklassigen Hirnen nicht weiter festgesetzt, vielmehr gehörte eins davon dem Volker. Der Volker hieß Sammet, saß zeitweise neben mir und malte mir immer blitzschnell enorme Pimmel über die ganze Buchseite in die Schulbücher uns auf die Handouts, bestimmt auch auf das vom Clauren. Nachweisen lässt sich das nicht, weil meine Schulunterlagen nach dem Abitur einem durch Weißenoher Klosterbräu befeuerten Autodafé zum Opfer gefallen sind, aber es besteht kein Grund, warum der Volker ausgerechnet den Clauren ausgelassen haben sollte.
Im Gegenteil hatte der Volker gerade in Claurens Fall besonderen Grund, mit seinen einfachen Mitteln Missbilligung auszudrücken. Sein Nachname Sammet erschien nämlich in verballhornender Form in dem Trivialtext aus dem 19. Jahrhundert — so das Thema der Deutschstunde. Alkoholischer Konsum und unter den ganz Verwegenen — darunter dem Volker — kamen bei den Fünfzehnjähirgen gerade in Mode, da ließ der uns unbekannte Clauren nach „Champagner und die Freude“ auch noch den „Liliensammet“ krachen. In einem literarischen Salon von 1819 wäre er auf so einen Lachschlager entweder stolz gewesen oder hätte sich richtiger Literatur zugewandt, und der Volker hieß paar Wochen lang der Liliensammet.
Alles was recht ist: Der Ausschnitt aus Unterirdische Liebe von Heinrich Clauren war von einem nicht mehr ermittelbaren Beauftragten des bayerischen Kultusministeriums geschickt gewählt, um Trivialtexte aus dem 19. Jahrhundert zu repräsentieren. Auf die Adjektivdichte hätte sich Goethe beim Verfertigen des Werther was einbilden können, und dieser Ehrgeiz besteht unter den Schreibern zum Abverkauf gedachter Literatur fort und fort.
Woher ich das weiß? Ach Gott, ich gehe halt einkaufen und lese Romanheftchen. Kurz vor der Kasse im Supermarkt auch Ihres Vertrauens stehen die in reicher Auswahl, und da soll sich niemand rausreden, dass er nie zum Lesen kommt. — Der Volker Liliensammet muss das nicht, der soll nach dem Abi Pilot gelernt haben.

——— Heinrich Clauren:
Unterirdische Liebe
in: W. G. Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen,
hg. W. G. Becker und Johann Friedrich Kind, Verlag Roch, Leipzig 1819,
Seite 165 bis 292, hier Seite 204 bis 207:
Adolphine streckte ihre zarten Glieder auf das weiche Moos; das heilige Rauschen in den Wipfeln der uralten Bäume, das Plätschern des zum Vater Rhein hinabeilenden Baches, lullten die Schlummermüde ein. Der Champagner und die Freude hatten den Liliensammt ihrer Wange geröthet; das Köpfchen lag in der rechten Schwanenhand; die linke ruhte auf dem schwellenden Moose. Freundlich lächelten die Purpurlippen, als schwebe ihr der Scherz des Tages vor der Freudetrunkenen Seele, der kleine Mund war halb geöffnet, wie eine eben sich entfaltende Rosenknospe; der Lilien=Busen wogte ruhig, und das niedlichste aller Füßchen im ganzen Rheingau war nur bis zur Zwickelspitze des blüthenweißen Strümpfchens sichtbar. Leise Lüfte vom fluthenden Rhein herauf, küßten ihr kühlend die brennende Stirn und das geschlossene Auge, und spielten heimlich mit dem lockigen Haar und den flatternden Bändern, und der lose Gott der Träume, der ihr auf des Champagners leichtem Schaume ein ganzes, mit mancherlei Gaukelwerk der Phantasie befrachtetes, bunt geflaggtes Schiffchen in des Herzens stillen Hafen gesandt, umfing sie jetzt mit seinen Blumenarmen.
Wohl mochte sie Dreiviertelstunden geschlafen haben, da rauschte es stärker im Gebüsch; sie ward nur halbwach, und gewahrte einen der kleinen hier heimischen Zwerghirsche, der sich durch das Gesträuch Bahn machte, und ihrem Lager sich näherte. Das niedliche Thier stutzte, als es Adolphinen in das Auge faßte; als sie aber mit leisen Schmeichelworten es kirrte, ganz still liegen blieb, und ihm kosend die Flaumenhand entgegen streckte, kam es, zahm und des Fütterns gewohnt, vertraulich heran, und leckte an den rosenen Fingern.
Ein zufälliges Geräusch in der Nähe verscheuchte den kleinen hübschen Hirsch; mit einem behenden Satz flog er seitwärts in das Gebüsch, und Adolphine entschlummerte bald wieder, doch währte es nicht lange, als sie wieder etwas rascheln hörte; Sie schlug die Augen, noch voll tiefen Schlafs, halb auf, und blinzelte durch die langen Wimpern, und wähnte, das dreuste Thierchen zurückkommen zu sehen; aber statt dessen lag der vermeintliche junge Graf Waldohna zu ihren Füßen, die Hände, in süßem Entzücken der Uiberraschung, vor der kühnen Brust gefaltet und im stummen Anschauen selig verloren.
War es des Champagner=Schaumes sanft brausender Rausch, oder die Feengewalt des seligen Augenblicks, oder die Macht des Schrecks, oder das Zauberspiel irgend eines wohlthätigen Liebesgottes, oder ein wundersamer Zug von natürlicher Frauen=List, — Adolphine gewann augenblicklich so viel Besinnung, sich den elektrischen Schlag, der sie mit dieser unvermutheten Erscheinung duchbebte, nicht im mindesten merken zu lassen; sie that, als ob sie fortschliefe, und lugte durch die Wimpern. Immer wacher und wacher wurden ihre Sinne; des brüselnden Schaumes bedrückende Nebel verflogen, sie sah und hörte alles deutlich, sie war sich ihrer selbst vollkommen bewußt, aber keiner ihrer Züge verrieth, was sich in ihrem Innern entfaltete; der Fremde glaubte, sie schliefe ruhig und fest.
Es war derselbe schöne junge Mann, den sie als Kind schon lieb gewonnen hatte, derselbe, der vor der Nonne und dem Klostergeschmeide kniete; derselbe, dessen Bild, ohne daß sie es damals ahnete, als das Ideal ihrer Liebe in ihrem jungfräulichen Herzen seit Jahren gewohnt; derselbe, den sie im Herrengarten gesehen hatte. Jetzt war es keine Täuschung mehr, sie sah ihn ja vor sich; sie sah ihm ja in das schmachtende Auge, in das männliche Gesicht voller Ernst und Milde; das waren jene schwärmerischen Züge, die sie so oft so wunderbar ergriffen hatten. Dieß der selbst im Schweigen beredete Mund; dieß die breite hochgewölbte Brust; dieß der nervige feste Arm; dieß die kräftige Gestalt, dieß die sanfte Anmuth im ganzen Wesen. —
„Du holdseliges, angebetetes Mädchen,“ rief er mit gedämpfter Stimme, und verschlang die Liebesfülle ihrer zauberischen Reize mit seinen glühenden Blicken; im Drange der ihn bestürmenden Gefühle bog er sich näher, und berührte mit dem Saume seiner Lippen, die wie frisch aufgeplatzte Granatblüthen zitternd bebten, leise die äußersten Kuppchen der rosigen Finger.
Adolphine schlief.
Kühner drückte er in die kleine Schneetiefe der weichen Flaumenhand, heimlich und verstohlen, einen sanften Kuß.
Adolphine schlief.
Und wenn alle Vierundzwanzigpfünder auf den Wällen der Feste Mainz, dicht neben ihrem Ohr, in einem Nu losgebrannt wären, sie hätte fortgeschlafen. So wohl, so unaussprechlich wohl that der still Verzückten die zarte Huldigung des, aus frühern Kindesträumen her, längst vertrauten heiß Geliebten.
Und so geht das weiter. Zugegeben ist diese ausgewalzte Unhandlung nicht ganz reizlos, dennoch darf man nach 1819 spoilern, dass Adolphine beim Ausschlafen ihren champagnerbedingten Damenspitzes vorerst ihre Unschuld behält.
Flaumenhand. Brüselnder Schaum. Das niedlichste aller Füßchen im ganzen Rheingau. Und — Uiberraschung: Liliensammet.

Bilder: Carl Friedrich Wilhelm Trautschold: Die Kunstlektion, Aquarell mit Weiß, 1870;
The Reconstruction of MyFlyAway, Fly Fly Fly, 15. November 2009.
Soundtrack: Friedel Hensch und die Cyprys: Die Försterlieserl, Walzerlied mit Instrumental-Begleitung, 1952:
Sonntag 7 von 7: Wo bleibt der Tröster?
Update zu Denkst du denn nicht an den Loup Garou?,
Ach! wie ists erhebend sich zu freuen,
Pfingsten, das liebliche Fest und
Sonntag 1 von 7: Denn „sieben, sieben“, flüstert es stets, und „sieben Wochen“ ihm in das Ohr:
Um unsere eigene Leitkultur auszukosten, feiern wir einmal alle sieben Sonntage der Osterzeit durch. Am sinnvollsten geschieht das anhand siebenzeiliger Strophen.
 Zu solchen Sonntagen nach Ostern zählt Pfingsten nach der Liturgie des römisch-katholischen Kirchenjahres nicht mehr — aber ein Organ, das zu wiederholten Malen fünf Adventssonntage, um nicht zu sagen: -freitage, gefeiert hat, darf unter seine Feier siebenzeiliger Strophen jederzeit einen siebenten Sonntag reihen, der gemäß jeder Liturgie nach Ostern liegt.
Zu solchen Sonntagen nach Ostern zählt Pfingsten nach der Liturgie des römisch-katholischen Kirchenjahres nicht mehr — aber ein Organ, das zu wiederholten Malen fünf Adventssonntage, um nicht zu sagen: -freitage, gefeiert hat, darf unter seine Feier siebenzeiliger Strophen jederzeit einen siebenten Sonntag reihen, der gemäß jeder Liturgie nach Ostern liegt.
Damit entfallen leider die schönen Lesungen und Psalmen für die Sonntage der Osterzeit. Damit die Serie dennoch dort wieder aufhört, wo sie angefangen hat, weil die Leser, wie Max Goldt einst wusste, auf zyklische Aufbauten total stehen, und um uns aus diesem Jammertal zu retten, legt die Droste in ihrem Zyklus des geistlichen Jahres nach ihrer vertrauten — der katholischen — Liturgie als Epistel die Apostelgeschichte 2,1–11 fest. Knappe Lesungen beschränken sich auf Kapitel 2,1–4, wir erweitern, weil wir die Leute gern ausreden lassen, auf 2,1–13 — nach der Vulgata und nach Luther letzter Hand 1545:
Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco : et factus est repente de cælo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ tamquam ignis, seditque supra singulos eorum : et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et cœperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis.
Erant autem in Jerusalem habitantes Judæi, viri religiosi ex omni natione, quæ sub cælo est. Facta autem hac voce, convenit multitudo, et mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentes : Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilæi sunt, et quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus ? Parthi, et Medi, et Ælamitæ, et qui habitant Mespotamiam, Judæam, et Cappadociam, Pontum, et Asiam, Phrygiam, et Pamphyliam, Ægyptum, et partes Libyæ, quæ est circa Cyrenen, et advenæ Romani, Judæi quoque, et Proselyti, Cretes, et Arabes : audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei. Stupebant autem omnes, et mirabantur ad invicem, dicentes : Quidnam vult hoc esse ? Alii autem irridentes dicebant : Quia musto pleni sunt isti.
VND als der tag der Pfingsten erfüllet war /waren sie alle einmütig bey einander. Vnd es geschach schnelle ein Brausen vom Himel / als eines gewaltigen Windes / vnd erfüllet das gantze Haus / da sie sassen. 3Vnd man sahe an jnen die Zungen zerteilet / als weren sie fewrig / Vnd er satzte sich auff einen jglichen vnter jnen / vnd wurden alle vol des heiligen Geists / Vnd fiengen an zu predigen mit andern Zungen / nach dem der Geist jnen gab aus zusprechen.
ES waren aber Jüden zu Jerusalem wonend / die waren gottfürchtige Menner / aus allerley Volck / das vnter dem Himel ist. Da nu diese stimme geschach /kam die Menge zusamen / vnd wurden verstörtzt /Denn es höret ein jglicher / das sie mit seiner Sprache redten. Sie entsatzten sich aber alle / verwunderten sich / vnd sprachen vnternander / Sihe / sind nicht diese alle / die da reden / aus Galilea? Wie hören wir denn / ein jglicher seine Sprache / darinnen wir geboren sind? Parther vnd Meder / vnd Elamiter / vnd die wir wonen in Mesopotamia / vnd in Judea / vnd Cappadocia / Ponto vnd Asia / Phrygia vnd Pamphylia / Egypten / vnd an den enden der Lybien bey Kyrenen / vnd Auslender von Rom / Jüden vnd Jüdege nossen / Kreter vnd Araber / Wir hören sie mit vnsern Zungen / die grossen Thaten Gottes reden. Sie entsatzten sich alle / vnd wurden jrre / vnd sprachen einer zu dem andern / Was wil das werden? Die andern aber hattens jren spot / vnd sprachen / Sie sind vol süsses Weins.
Eine Art Regiefehler ist der Dichterin des Pfingstsonntages bei der Zählung der „vierzig Tag | Und Nächte“ unterlaufen: Am Pfingstsonntag sind seit Christi Himmelfahrt zehn, seit Ostern fünfzig Tage vergangen.
——— Annette von Droste-Hülshoff:
Am Pfingstsonntage
ab 1819, vorläufiger Abschluss 1839, posthum veröffentlicht
als: Das geistliche Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage,
hg. Christof Bernhard Schlüter, Stuttgart 1851:
Still war der Tag, die Sonne stand
So klar an unbefleckten Tempelhallen;
Die Luft in Orientes Brand
Wie ausgedorrt, ließ matt die Flügel fallen.
Ein Häuflein sieh, so Mann als Greis,
Auch Frauen, knieend; keine Worte hallen,
Sie bethen leis.Wo bleibt der Tröster, treuer Hort,
Den scheidend doch verheißen du den Deinen?
Nicht zagen sie, fest steht dein Wort,
Doch bang und trübe muß die Zeit wohl scheinen.
Die Stunde schleicht; schon vierzig Tag
Und Nächte harrten wir in stillem Weinen
Und sahn dir nach.Wo bleibt er? wo nur? Stund an Stund,
Minute will sich reihen an Minuten.
Wo bleibt er denn? — und schweigt der Mund:
Die Seele spricht es unter leisem Bluten.Der Wirbel stäubt, der Tieger ächzt
Und wälzt sich keuchend durch die sandgen Fluthen,
Sein Rachen lechzt.
Da, horch, ein Säuseln hebt sich leicht!
Es schwillt und schwillt, und steigt wie Sturmes Rauschen.
Die Gräser stehen ungebeugt;
Die Palme starr und staunend scheint zu lauschen.
Was zittert durch die fromme Schaar,
Was läßt sie bang und glühe Blicke tauschen?
Schaut auf! nehmt wahr!Er ists, er ists; die Flamme zuckt
Ob jedem Haupt; welch wunderbares Kreisen,
Was durch die Adern quillt und ruckt!
Die Zukunft bricht; es öffnen sich die Schleusen,
Und unaufhaltsam strömt das Wort,
Bald Heroldsruf und bald im flehend leisen
Geflüster fort.O Licht o Tröster, bist du, ach!
Nur jener Zeit, nur jener Schaar verkündet?
Nicht uns, nicht überall, wo wach
Und trostesbaar sich eine Seele findet?
Ich schmachte in der schwülen Nacht;
O leuchte, eh das Auge ganz erblindet!
Es weint und wacht.

Peintures: die Frühlingsallegorien von William-Adolphe Bouguereau in umgekehrt chronologischer Reihenfolge, weil nur das früheste ein Querformat ist:
- Rêve de printemps, 1901;
- La brise du printemps, 1895;:
- Chansons de printemps, 1889;
- Le printemps, 1886;
- Le printemps, 1858,
via Wikimedia Commons und Bareviewed.
Minute will sich reihen an Minuten: Kroke: Time, aus: The Sounds of the Vanishing World, 1999:
Sonntag 3 von 7: Wir wollen ihm klingen ein böses Lied; die Ohren sollen ihm gellen
Update zu Den Bach runter
und Du bist’s (Er ist’s):
Um unsere eigene Leitkultur auszukosten, feiern wir einmal alle sieben Sonntage der Osterzeit durch. Am sinnvollsten geschieht das anhand siebenzeiliger Strophen.
3. Sonntag nach Ostern: Jubilate
Iubilate Deo, omnis terra.
Ein Psalmlied / vor zu singen.
JAuchzet Gott alle Lande /Psalm 66,1.
Ein so gar nicht biedermeierliches und erst recht nicht jubilierendes Gedicht von Hochwürden Eduard Mörike klingt, seiner Struppigkeit und seinem Mut zum Spiel mit der Volksliedform nach — 1 + 6 Verse! trotzige Lebens- und Mordlust in einem Hochzeitslied! — zu schließen, nach dem Jugendwerk eines frühen Dorfpunkers, entstand dem 58-jährigen Dorfpfarrer aber für eine obskur gewordene Zeitschrift zu einem obskur bleibenden Holzschnitt.
——— Eduard Mörike:
Die Tochter der Heide
Erstdruck zu einem Holzschnitt in: Freya. Illustrirte Blätter für die gebildete Welt. Zweiter Jahrgang.
Mit 125 Holzschnitten und 18 Kunstblättern in Stahlstich und Farbendruck,
Krais und Hoffmann, Stuttgart 1862,
gesammelt in: Gedichte, 1867:
Wasch dich, mein Schwesterchen, wasch dich!
Zu Robins Hochzeit gehn wir heut:
Er hat die stolze Ruth gefreit.
Wir kommen ungebeten;
Wir schmausen nicht, wir tanzen nicht
Und nicht mit lachendem Gesicht
Komm ich vor ihn zu treten.Strähl dich, mein Schwesterchen, strähl dich!
Wir wollen ihm singen ein Rätsel-Lied,
Wir wollen ihm klingen ein böses Lied;
Die Ohren sollen ihm gellen.
Ich will ihr schenken einen Kranz
Von Nesseln und von Dornen ganz:
Damit fährt sie zur Hölle!Schick dich, mein Schwesterchen, schmück dich!
Derweil sie alle sind am Schmaus,
Soll rot in Flammen stehn das Haus,
Die Gäste schreien und rennen.
Zwei sollen sitzen unverwandt,
Zwei hat ein Sprüchlein festgebannt;
Zu Kohle müssen sie brennen.Lustig, mein Schwesterchen, lustig!
Das war ein alter Ammensang.
Den falschen Rob vergaß ich lang.
Er soll mich sehen lachen!
Hab ich doch einen andern Schatz,
Der mit mir tanzet auf dem Platz –
Sie werden Augen machen!
Sich strählende russische Schwester aus der empfohlenen Fachliteratur:
Sinaida Jewgenjewna Serebrjakowa: Selbstporträt am Toilettentisch, 1909,
Öl auf Leinwand, 75 cm auf 65 cm, Staatliche Tretjakow-Galerie Moskau,
via Karin Sagner: Schöne Frauen: Von Haut und Haaren, Samt und Seife – die gepflegte Frau in der Kunst,
Elisabeth Sandmann Verlag, München 2011.
Soundtracks: die Bach-Kantaten zu Jubilate:
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12, 1714;
Ihr werdet weinen und heulen, BWV 103, 1725;
Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146, ca. 1726:
Sonntag 1 von 7: Denn „sieben, sieben“, flüstert es stets, und „sieben Wochen“ ihm in das Ohr
Update zu Ho, ho, meine arme Seele!
Dem Knaben graut im Haidekraut:
Um unsere eigene Leitkultur auszukosten, feiern wir einmal alle sieben Sonntage der Osterzeit durch. Am sinnvollsten geschieht das anhand siebenzeiliger Strophen.
1. Sonntag nach Ostern: Quasimodogeniti:
Quasi modo geniti infantes, halleluja, rationabile sine dolo lac concupiscite, halleluja.
Vnd seid girig nach der vernünfftigen lautern Milch / als die jtzt gebornen Kindlin / Auff das jr durch die selbigen zunemet.
1. Brief des Petrus 2,2.
Fangen wir an mit dem übermütigen Bravourstück Das Fegefeuer des westphälischen Adels der immer noch unterschätzten Droste. Zu Quasimodogeniti, vulgo dem Weißen Sonntag, kommt es verspätet, weil die Wendung „in froner Nacht“ im Sinne von „dem Herrn zugehörig“ den Abend der Eucharistie am Gründonnerstag bedeutet. Der „historische“ Ort des titelstiftenden westfälischen Fegefeuers ist der als Lutterberg oder Butterberg überlieferte heute so genannte, allerdings bis auf weiteres fiktive Löwenberg beim ehemaligen Augustinerkloster Böddeken, Kreis Paderborn.
 Der Stoff war zuerst von Wilhelm Langewiesche unter dem Pseudonym L. Wiese und derselben Überschrift für seine eigene Sammlung Sagen- und Mährchenwald im Blüthenschmuck 1841 bearbeitet, danach als Zweitverwendung vom Herausgeber Levin Schücking für Das malerische und romantische Westphalen abgelehnt worden. Der Auftrag für die Ballade erging an Schückings „mütterliche Freundin“ Droste.
Der Stoff war zuerst von Wilhelm Langewiesche unter dem Pseudonym L. Wiese und derselben Überschrift für seine eigene Sammlung Sagen- und Mährchenwald im Blüthenschmuck 1841 bearbeitet, danach als Zweitverwendung vom Herausgeber Levin Schücking für Das malerische und romantische Westphalen abgelehnt worden. Der Auftrag für die Ballade erging an Schückings „mütterliche Freundin“ Droste.
Als deren Quellen kommen in Frage: Bernhard Wittes Klosterchronik von Böddeken: Historiae Antiquae Occidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae von vor 1442, gedruckt erst 1788 in Münster, dort Seite 613 bis 616: Purgatorium Nobilium Westphalorum, und H. Stahl alias Jodocus Donatus Hubertus Temme: Westphälische Sagen und Geschichten, Büschler’sche Verlagsbuchhandlung, Elberfeld 1831, 1. Bändchen, darin Seite 46 bis 62: Das Fegfeuer des westphälischen Adels. Eine Sage, die bis heute in der Bibliothek von Haus Hülshoff vorrätig sind.
In diesem einen Fall mit der handlungstragenden Siebenzahl dürfen wir annehmen, dass die Dichterin, die ungewöhnlich oft zur siebenzeiligen Strophenform neigt, dieselbe hier absichtlich dem Inhalt angepasst hat. Das Reimschema ABABCCB ist technisch beneidenswert sauber durchgehalten. Die sich aufdrängenden acht Verse wären marschiert, die sieben tanzen.
——— Annette von Droste-Hülshoff:
Das Fegefeuer des westphälischen Adels.
Frühling 1841, anonym aus: Ferdinand Freiligrath, Levin Schücking (Hrsgg.):
Das malerische und romantische Westphalen, Barmen und Leipzig 1842, Seite 185 bis 188,
in: Gedichte, Ausgabe 1844:
Wo der selige Himmel, das wissen wir nicht,
Und nicht, wo der greuliche Höllenschlund,
Ob auch die Wolke zittert im Licht,
Ob siedet und qualmet Vulkanes Mund;
Doch wo die westphälischen Edeln müssen
Sich sauber brennen ihr rostig Gewissen,
Das wissen wir alle, das ward uns kund.Grau war die Nacht, nicht öde und schwer,
Ein Aschenschleier hing in der Luft;
Der Wanderbursche schritt flink einher,
Mit Wollust saugend den Heimatduft;
O bald, bald wird er schauen sein Eigen,
Schon sieht am Lutterberge er steigen
Sich leise schattend die schwarze Kluft.Er richtet sich, wie Trompetenstoß
Ein Holla ho! seiner Brust entsteigt –
Was ihm im Nacken? ein schnaubend Roß,
An seiner Schulter es rasselt, keucht,
Ein Rappe – grünliche Funken irren
Über die Flanken, die knistern und knirren,
Wie wenn man den murrenden Kater streicht.„Jesus Maria!“ – er setzt seitab,
Da langt vom Sattel es überzwerch –
Ein eherner Griff, und in wüstem Trab
Wie Wind und Wirbel zum Lutterberg!
An seinem Ohre hört er es raunen
Dumpf und hohl, wie gedämpfte Posaunen,
So an ihm raunt der gespenstige Scherg‘:„Johannes Deweth! ich kenne dich!
Johann! du bist uns verfallen heut‘!
Bei deinem Heile, nicht lach noch sprich,
Und rühre nicht an was man dir beut;
Vom Brode nur magst du brechen in Frieden,
Ewiges Heil ward dem Brode beschieden,
Als Christus in froner Nacht es geweiht!“ –Ob mehr gesprochen, man weiß es nicht,
Da seine Sinne der Bursche verlor,
Und spät erst hebt er sein bleiches Gesicht
Vom Estrich einer Halle empor;
Um ihn Gesumme, Geschwirr, Gemunkel,
Von tausend Flämmchen ein mattes Gefunkel,
Und drüber schwimmend ein Nebelflor.Er reibt die Augen, er schwankt voran,
An hundert Tischen, die Halle entlang,
All edle Geschlechter, so Mann an Mann;
Es rühren die Gläser sich sonder Klang,
Es regen die Messer sich sonder Klirren,
Wechselnde Reden summen und schwirren,
Wie Glockengeläut, ein wirrer Gesang.Ob jedem Haupte des Wappens Glast,
Das langsam schwellende Tropfen speit,
Und wenn sie fallen, dann zuckt der Gast,
Und drängt sich einen Moment zur Seit‘;
Und lauter, lauter dann wird das Rauschen,
Wie Stürme die zornigen Seufzer tauschen,
Und wirrer summet das Glockengeläut.Strack steht Johann wie ein Lanzenknecht,
Nicht möchte der gleißenden Wand er traun,
Noch wäre der glimmernde Sitz ihm recht,
Wo rutschen die Knappen mit zuckenden Braun.
Da muß, o Himmel, wer sollt‘ es denken!
Den frommen Herrn, den Friedrich von Brenken,
Den alten stattlichen Ritter er schaun.„Mein Heiland, mach‘ ihn der Sünden bar!“
Der Jüngling seufzet in schwerem Leid;
Er hat ihm gedienet ein ganzes Jahr;
Doch ungern kredenzt er den Becher ihm heut!
Bei jedem Schlucke sieht er ihn schüttern,
Ein blaues Wölkchen dem Schlund entzittern,
Wie wenn auf Kohlen man Weihrauch streut.O manche Gestalt noch dämmert ihm auf,
Dort sitzt sein Pate, der Metternich,
Und eben durch den wimmelnden Hauf
Johann von Spiegel, der Schenke, strich;
Prälaten auch, je viere und viere,
Sie blättern und rispeln im grauen Breviere,
Und zuckend krümmen die Finger sich.Und unten im Saale, da knöcheln frisch
Schaumburger Grafen um Leut‘ und Land,
Graf Simon schüttelt den Becher risch,
Und reibt mitunter die knisternde Hand;
Ein Knappe nähet, er surret leise –
Ha, welches Gesumse im weiten Kreise,
Wie hundert Schwärme an Klippenrand!
„Geschwind den Sessel, den Humpen wert,
Den schleichenden Wolf geschwinde herbei!“
Horch, wie es draußen rasselt und fährt!
Barhaupt stehet die Massonei,
Hundert Lanzen drängen nach binnen,
Hundert Lanzen und mitten darinnen
Der Asseburger, der blutige Weih!Und als ihm alles entgegenzieht,
Da spricht Johannes ein Stoßgebet:
Dann risch hinein! sein Ärmel sprüht,
Ein Funken über die Finger ihm geht.
Voran – da „sieben“ schwirren die Lüfte
„Sieben, sieben, sieben,“ die Klüfte,
„In sieben Wochen, Johann Deweth!“Der sinkt auf schwellenden Rasen hin,
Und schüttelt gegen den Mond die Hand,
Drei Finger die bröckeln und stäuben hin,
Zu Asch‘ und Knöchelchen abgebrannt.
Er rafft sich auf, er rennt, er schießet,
Und ach, die Vaterklause begrüßet
Ein grauer Mann, von keinem gekannt,Der nimmer lächelt, nur des Gebets
Mag pflegen drüben im Klosterchor,
Denn „sieben, sieben“, flüstert es stets,
Und „sieben Wochen“ ihm in das Ohr.
Und als die siebente Woche verronnen,
Da ist er versiegt wie ein dürrer Bronnen,
Gott hebe die arme Seele empor!
Bilder: Jugendbildnis ohne Jahr, via Annette von Droste-Gesellschaft e.V.;
Else Hertzer: Buchillustration zu Das Fegefeuer des westfälischen Adels,
Lithographie ohne Jahr, via Goodbooks Wien.
Soundtracks: die Bach-Kantaten zu Quasimodogeniti:
Am Abend aber desselbigen Sabbats, BWV 42, 1725,
und Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67, 1724:
Wenn–dann (weiß ich auch nicht)
Update zu Des Frühlings beklommnes Herz und
Süßer Freund, das bißchen Totsein hat ja nichts zu bedeuten:
Adalbert Stifter ist der Wald. Es lassen sich sogar trefflich Kränze aus seinen verschiedenen Gewächsen winden:
——— Adalbert Stifter:
Der Nachsommer
3. Band, 4. Der Rückblick, 1857:
Sie fragte mich, ob ich denn nicht gerne in die Stadt gehe.
Ich sagte, daß ich nicht gerne gehe, daß es hier gar so schön sei, und daß es mir vorkomme, in der Stadt werde alles anders werden.
‚Es ist wirklich sehr schön‘, antwortete sie, ‚hier sind wir alle viel mehr beisammen, in der Stadt kommen Fremde dazwischen, man wird getrennt, und es ist, als wäre man in eine andere Ortschaft gereist. Es ist doch das größte Glück, jemanden recht zu lieben.‘ […]
Es begann nun eine merkwürdige Zeit. In meinem und Mathildens Leben war ein Wendepunkt eingetreten. Wir hatten uns nicht verabredet, daß wir unsere Gefühle geheim halten wollen; dennoch hielten wir sie geheim, wir hielten sie geheim vor dem Vater, vor der Mutter, vor Alfred und vor allen Menschen. Nur in Zeichen, die sich von selber gaben, und in Worten, die nur uns verständlich waren, und die wie von selber auf die Lippen kamen, machten wir sie uns gegenseitig kund. Tausend Fäden fanden sich, an denen unsere Seelen zu einander hin und her gehen konnten, und wenn wir in dem Besitze von diesen tausend Fäden waren, so fanden sich wieder tausend, und mehrten sich immer. Die Lüfte, die Gräser, die späten Blumen der Herbstwiese, die Früchte, der Ruf der Vögel, die Worte eines Buches, der Klang der Saiten, selbst das Schweigen waren unsere Boten. Und je tiefer sich das Gefühl verbergen mußte, desto gewaltiger war es, desto drängender loderte es in dem Innern. Auf Spaziergänge gingen wir drei, Mathilde, Alfred und ich, jetzt weniger als sonst, es war, als scheuten wir uns vor der Anregung. Die Mutter reichte oft den Sommerhut und munterte auf. Das war dann ein großes, ein namenloses Glück. Die ganze Welt schwamm vor den Blicken, wir gingen Seite an Seite, unsere Seelen waren verbunden, der Himmel, die Wolken, die Berge lächelten uns an, unsere Worte konnten wir hören, und wenn wir nicht sprachen, so konnten wir unsere Tritte vernehmen, und wenn auch das nicht war, oder wenn wir stille standen, so wußten wir, daß wir uns besaßen, der Besitz war ein unermeßlicher, und wenn wir nach Hause kamen, war es, als sei er noch um ein Unsägliches vermehrt worden. Wenn wir in dem Hause waren, so wurde ein Buch gereicht, in dem unsere Gefühle standen, und das andere erkannte die Gefühle, oder es wurden sprechende Musiktöne hervorgesucht, oder es wurden Blumen in den Fenstern zusammengestellt, welche von unserer Vergangenheit redeten, die so kurz und doch so lang war. Wenn wir durch den Garten gingen, wenn Alfred um einen Busch bog, wenn er in dem Gange des Weinlaubes vor uns lief, wenn er früher aus dem Haselgebüsche war als wir, wenn er uns in dem Innern des Gartenhauses allein ließ, konnten wir uns mit den Fingern berühren, konnten uns die Hand reichen, oder konnten gar Herz an Herz fliegen, uns einen Augenblick halten, die heißen Lippen an einander drücken und die Worte stammeln: ‚Mathilde, dein auf immer und auf ewig, nur dein allein, und nur dein, nur dein allein!‘ ‚O ewig dein, ewig, ewig, Gustav, dein, nur dein, und nur dein allein.‘ Diese Augenblicke waren die allerglückseligsten.
~~~\~~~~~~~/~~~
Witiko
1. Band, 1: Es klang fast wie Gesang von Lerchen, 1865:
Sogleich trat das Mädchen, welches keine Rosen hatte, in den Wald zurück, das andere blieb stehen. Der Reiter ging zu demselben hin. Da er bei ihm angekommen war, sagte er: „Was stehst du mit deinen Rosen hier da?“
„Ich stehe hier in meiner Heimat da“, antwortete das Mädchen; „stehst du auch in derselben, daß du frägst, oder kamst du wo anders her?“
„Ich komme anders wo her“, sagte der Reiter.
„Wie kannst du dann fragen?“ entgegnete das Mädchen.
„Weil ich es wissen möchte“, antwortete der Reiter.
„Und wenn ich wissen möchte, was du willst“, sagte das Mädchen.
„So würde ich es dir vielleicht sagen“, antwortete der Reiter.
„Und ich würde dir vielleicht sagen, warum ich mit den Rosen hier stehe“, entgegnete das Mädchen.
„Nun, warum stehst du da?“ fragte der Reiter.
„Sage zuerst, was du willst“, erwiderte das Mädchen.
„Ich weiß nicht, warum ich es nicht sagen sollte“, erwiderte der Reiter, „ich suche mein Glück.“
„Dein Glück? hast du das verloren?“ sagte das Mädchen, „oder suchst du ein anderes Glück, als man zu Hause hat?“
„Ja“, antwortete der Reiter, „ich gehe nach einem großen Schicksale, das dem rechten Manne ziemt.“
„Kennst du dieses Schicksal schon, und weißt du, wo es liegt?“ fragte das Mädchen.
„Nein“, sagte der Reiter, „das wäre ja nichts Rechtes, wenn man schon wüßte, wo das Glück liegt, und nur hingehen dürfte, es aufzuheben. Ich werde mir mein Geschick erst machen.“
„Und bist du der rechte Mann, wie du sagst?“ fragte das Mädchen.
„Ob ich der rechte Mann bin“, antwortete der Reiter, „siehe, das weiß ich noch nicht; aber ich will in der Welt das Ganze tun, was ich nur immer tun kann.“
„Dann bist du vielleicht der Rechte“, erwiderte das Mädchen, „bei uns, sagt der Vater, tun sie immer weniger, als sie können. Du mußt aber ausführen, was du sagst, nicht bloß es sagen. Dann weiß ich aber doch noch nicht, ob du ein Schicksal machen kannst. Ich weiß auch nicht, ob du ein Schicksal machst, wenn du in unserem Walde auf der Wiese stehst.“
„Ich darf da stehen“, sagte der Reiter, „denn heute ist Sonntag, der Ruhetag für Menschen und Tiere, wenn es nicht eine Not und Notwendigkeit anders heischt. Mein Pferd habe ich eingestellt. Ich bin in den Wald herauf gegangen, zu beten. Und für den übrigen Tag will ich versuchen, ob ich nicht zu dem Steine der drei Sessel hinauf gelangen kann.“
„Das kannst du“, sagte das Mädchen, „es geht ein Pfad hinauf, den du immer wieder leicht findest, wenn du ihn einmal verlierst. Weil aber der Stein von dem Grunde, der um ihn herum ist, wie eine gerade Mauer aufsteigt, so haben sie Stämme zusammen gezimmert, haben dieselben an ihn gelehnt, und durch Hölzer eine Treppe gemacht, daß man auf seine Höhe gelangen kann. Du mußt aber oben sorgsam sein, daß dein Haupt nicht irre wird; denn du stehst in der Luft allein über allen Wipfeln.“
„Bist du schon oben gestanden?“ fragte der Reiter.
„Ich werde doch, da ich so nahe bin“, antwortete das Mädchen.
„Nun“, sagte der Reiter, „wenn du schon oben gestanden bist, so werde auch ich oben stehen.“
„Und wenn du heute von den drei Sesseln herunter kommst“, sagte das Mädchen, „dann reitest du morgen nach deinem Geschicke weiter?“
„Ich werde weiter reiten“, sagte er; „warum hast du die Rosen?“
„Muß ich antworten, wenn ich gefragt werde?“ sagte das Mädchen.
„Wenn die Eltern fragen, mußt du antworten“, entgegnete der Reiter, „wenn jemand anderer artig fragt, sollst du, und wenn du es versprochen hast, mußt du antworten.“
„So will ich dir so viel sagen, als du gesagt hast“, antwortete das Mädchen, „ich trage die Rosen, weil ich will.“
„Und warum willst du denn?“ fragte der Reiter.
„Für den Willen gibt es keine Ursache“, sagte das Mädchen.
„Wenn man vernünftig ist, gibt es für den Willen immer eine Ursache“, erwiderte der Reiter.
„Das ist nicht wahr“, sagte das Mädchen, „denn es gibt auch Eingebungen.“
„Trägst du die Rosen aus Eingebung?“ fragte der Reiter.
„Das weiß ich nicht“, entgegnete das Mädchen, „aber wenn du mir mehr von dir sagst, so sage ich dir auch mehr.“
„Ich kann dir nicht viel sagen“, antwortete der Reiter, „ich habe eine Mutter, die in Baiern wohnt, mein Vater ist gestorben, und ich reite jetzt in die Welt, um meine Lebenslaufbahn zu beginnen.“
„So will ich dir auch etwas sagen“, erwiderte das Mädchen. „Meine Eltern haben von hier weiter oben ein Haus. Wir würden es erreichen, wenn wir hier in den Wald gingen, wo ich mit meiner Gespanin herausgetreten bin, wenn wir in dem Walde nach aufwärts gingen, bis wir ein Wasser rauschen hörten, und wenn wir dann zu dem Wasser gingen, und demselben immer entgegen, dann würden endlich Wiesen und Felder kommen, und in ihnen das Haus. An dem Hause ist ein Garten, wo die Sonnenseite ist, und in dem Garten stehen viele Blumen. Und an der Hinterseite des Hauses geht ein Riegel gegen die Tannen, auf welchem viele Waldrosen stehen, und diese nehme ich oft.“
„Hast du die Rosen heute aus Eingebung genommen? Sie sind mir ein Zeichen, daß meine Fahrt gelingen wird“, sagte der Reiter.
„Ich habe einen Metallring, in welchen die Rosenstiele passen“, sagte das Mädchen, „habe heute Rosen genommen, habe sie in den Ring gesteckt, und den Ring auf das Haupt getan.“
„Weil wir noch mehr sprechen werden“, sagte der Reiter, „so gehen wir ein wenig an dem Waldsaume hin, woher du mich kommen gesehen hast. Da werden wir Steine finden, welche zu Sitzen taugen. Auf dieselben können wir uns setzen, und dort sprechen.“
„Ich weiß es nicht, ob ich noch mehreres mit dir sprechen werde“, antwortete das Mädchen, „aber ich gehe mit dir zu den Steinen, und setze mich ein wenig zu dir. Ich kenne die Steine, ich selber habe die Sitze machen lassen. Im Sommer ist es am Vormittage dort sehr heiß, am Nachmittage aber schattig. Im Herbste ist es vormittags lieblich und mild.“
Sie wandelten nun in der Richtung an dem Saume des Waldes hin, in welcher der Reiter zu den Mädchen hergekommen war. Sie hatten bald jene Steine erreicht, an denen der Reiter versucht hatte, ob sie zu Sitzen tauglich wären. Er blieb stehen, und harrte, bis das Mädchen sich gesetzt hatte. Es setzte sich auf einen glatten Stein. Der Reiter setzte sich zu ihrer Linken auf einen, der etwas niederer war, so daß nun sein Angesicht mit dem ihrigen fast in gleicher Höhe war. Das Schwert ragte zu seiner Linken in die niederen Steine hinab. Sie sprachen nun nichts.
Nach einer Weile sagte der Reiter: „So rede etwas.“
„So rede du etwas“, antwortete sie, „du hast gesagt, daß du mit mir noch sprechen willst.“
„Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte“, entgegnete er.
„Nun, ich auch nicht“, sagte sie.
~~~\~~~~~~~/~~~
Aus dem Bayrischen Walde
November 1867, Erstdruck posthum in: Die Katholische Welt, Aachen, April 1868, Seite 122 ff.,
gesammelt in: Prager Ausgabe, Band XV, Reichenberg 1935,
das Letzte, was Stifter je zur Veröffentlichung freigegeben hat:
Als wir die Häuser um die Kirche hinter uns hatten, war wieder die weiße Wildnis vor uns, und das Grau des Schneefalles um und über uns, sonst nichts. Die Bahn war hoch oben, zu beiden Seiten war der tiefe lockere Schnee, und sie hatte nur die Breite eines Schlittens.
„Martin“, sagte ich, „wenn uns ein Schlitten begegnet.“
„Es begegnet uns keiner“, sagte er.
„Wenn uns aber doch einer begegnet“, sagte ich wieder.
„Es begegnet uns keiner“, sagte er.
„Wenn uns aber doch einer begegnet“, beharrte ich.
„Dann weiß ich es nicht“, sagte er.
Es begegnete uns aber keiner.
Die Wölfin meint: „Die Gegend kenn ich. Die sind da wirklich so.“
Bilder: Adalbert Stifter: Blick auf die Falkenmauer aus der Gegend von Kremsmünster, ca. 1825,
via Silvae: Adalbert Stifter, 23. Oktober 2010;
Bayerwaldgipfelstürmer: Dreisessel (1333m) — Bay. Plöckenstein (1365m), 3. Mai 2011;
Georg Knaus aus Freyung, Sägewerksmeister in Vilshofen: Da Knaus der Woche: Magischer Sonnenuntergang am Dreisessel, 23. Februar 2015 mit der Bischof-Neumann-Kapelle für da Hog’n. Onlinemagazin ausm Woid;
Ferdinand Stiller aus Schwarzenberg fürs Wirtshaus Rosenberger Gut.
Soundtrack: Georg Ringsgwandl: Oberpfalz, aus: Woanders, 2016:
Das sanfte Gesetz
Update zu Zeichenstifter und
Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen:
——— Adalbert Stifter:
Vorrede
Im Herbste 1852, zu: Bunte Steine. Ein Festgeschenk.
Verlag von Gustav Heckenast, Pest. Leipzig, bei Georg Wigand, 1853:
Weil wir aber schon einmal von dem Großen und Kleinen reden, so will ich meine Ansichten darlegen, die wahrscheinlich von denen vieler anderer Menschen abweichen. Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, das Wachsen der Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen des Himmels, das Schimmern der Gestirne halte ich für groß: das prächtig einherziehende Gewitter, den Blitz, welcher Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer als obige Erscheinungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen viel höherer Gesetze sind. Sie kommen auf einzelnen Stellen vor, und sind die Ergebnisse einseitiger Ursachen. Die Kraft, welche die Milch im Töpfchen der armen Frau empor schwellen und übergehen macht, ist es auch, die die Lava in dem feuerspeienden Berge empor treibt und auf den Flächen der Berge hinab gleiten läßt. Nur augenfälliger sind diese Erscheinungen und reißen den Blick des Unkundigen und Unaufmerksamen mehr an sich, während der Geisteszug des Forschers vorzüglich auf das Ganze und Allgemeine geht und nur in ihm allein Großartigkeit zu erkennen vermag, weil es allein das Welterhaltende ist. Die Einzelheiten gehen vorüber, und ihre Wirkungen sind nach kurzem kaum noch erkennbar. Wir wollen das Gesagte durch ein Beispiel erläutern. Wenn ein Mann durch Jahre hindurch die Magnetnadel, deren eine Spitze immer nach Norden weist, tagtäglich zu festgesetzten Stunden beobachtete und sich die Veränderungen, wie die Nadel bald mehr bald weniger klar nach Norden zeigt, in einem Buche aufschriebe, so würde gewiß ein Unkundiger dieses Beginnen für ein kleines und für Spielerei ansehen; aber wie ehrfurchterregend wird dieses Kleine und wie begeisterungerweckend diese Spielerei, wenn wir nun erfahren, daß diese Beobachtungen wirklich auf dem ganzen Erdboden angestellt werden, und daß aus den daraus zusammengestellten Tafeln ersichtlich wird, daß manche kleine Veränderungen an der Magnetnadel oft auf allen Punkten der Erde gleichzeitig und in gleichem Maße vor sich gehen, daß also ein magnetisches Gewitter über die ganze Erde geht, daß die ganze Erdoberfläche gleichzeitig gleichsam ein magnetisches Schauern empfindet. Wenn wir, so wie wir für das Licht die Augen haben, auch für die Elektrizität und den aus ihr kommenden Magnetismus ein Sinneswerkzeug hätten, welche große Welt, welche Fülle von unermeßlichen Erscheinungen würde uns da aufgetan sein. Wenn wir aber auch dieses leibliche Auge nicht haben, so haben wir dafür das geistige der Wissenschaft, und diese lehrt uns, daß die elektrische und magnetische Kraft auf einem ungeheuren Schauplatze wirke, daß sie auf der ganzen Erde und durch den ganzen Himmel verbreitet sei, daß sie alles umfließe und sanft und unablässig verändernd, bildend und lebenerzeugend sich darstelle. Der Blitz ist nur ein ganz kleines Merkmal dieser Kraft, sie selber aber ist ein Großes in der Natur. Weil aber die Wissenschaft nur Körnchen nach Körnchen erringt, nur Beobachtung nach Beobachtung macht, nur aus Einzelnem das Allgemeine zusammen trägt, und weil endlich die Menge der Erscheinungen und das Feld des Gegebenen unendlich groß ist, Gott also die Freude und die Glückseligkeit des Forschens unversieglich gemacht hat, wir auch in unseren Werkstätten immer nur das Einzelne darstellen können, nie das Allgemeine, denn dies wäre die Schöpfung: so ist auch die Geschichte des in der Natur Großen in einer immerwährenden Umwandlung der Ansichten über dieses Große bestanden. Da die Menschen in der Kindheit waren, ihr geistiges Auge von der Wissenschaft noch nicht berührt war, wurden sie von dem Nahestehenden und Auffälligen ergriffen und zu Furcht und Bewunderung hingerissen; aber als ihr Sinn geöffnet wurde, da der Blick sich auf den Zusammenhang zu richten begann, so sanken die einzelnen Erscheinungen immer tiefer, und es erhob sich das Gesetz immer höher, die Wunderbarkeiten hörten auf, das Wunder nahm zu.
So wie es in der äußeren Natur ist, so ist es auch in der inneren, in der des menschlichen Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit, Bezwingung seiner selbst, Verstandesgemäßheit, Wirksamkeit in seinem Kreise, Bewunderung des Schönen, verbunden mit einem heiteren, gelassenen Sterben, halte ich für groß: mächtige Bewegungen des Gemütes, furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach Rache, den entzündeten Geist, der nach Tätigkeit strebt, umreißt, ändert, zerstört, und in der Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich nicht für größer, sondern für kleiner, da diese Dinge so gut nur Hervorbringungen einzelner und einseitiger Kräfte sind, wie Stürme, feuerspeiende Berge, Erdbeben. Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet wird. Es gibt Kräfte, die nach dem Bestehen des Einzelnen zielen. Sie nehmen alles und verwenden es, was zum Bestehen und zum Entwickeln desselben notwendig ist. Sie sichern den Bestand des Einen und dadurch den aller. Wenn aber jemand jedes Ding unbedingt an sich reißt, was sein Wesen braucht, wenn er die Bedingungen des Daseins eines anderen zerstört, so ergrimmt etwas Höheres in uns, wir helfen dem Schwachen und Unterdrückten, wir stellen den Stand wieder her, daß er ein Mensch neben dem andern bestehe und seine menschliche Bahn gehen könne, und wenn wir das getan haben, so fühlen wir uns befriedigt, wir fühlen uns noch viel höher und inniger, als wir uns als Einzelne fühlen, wir fühlen uns als ganze Menschheit. Es gibt daher Kräfte, die nach dem Bestehen der gesamten Menschheit hinwirken, die durch die Einzelkräfte nicht beschränkt werden dürfen, ja im Gegenteile beschränkend auf sie selber einwirken. Es ist das Gesetz dieser Kräfte, das Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das Gesetz, das will, daß jeder geachtet, geehrt, ungefährdet neben dem anderen bestehe, daß er seine höhere menschliche Laufbahn gehen könne, sich Liebe und Bewunderung seiner Mitmenschen erwerbe, daß er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein Kleinod für alle andern Menschen ist. Dieses Gesetz liegt überall, wo Menschen neben Menschen wohnen, und es zeigt sich, wenn Menschen gegen Menschen wirken. Es liegt in der Liebe der Ehegatten zu einander, in der Liebe der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, in der Liebe der Geschwister, der Freunde zu einander, in der süßen Neigung beider Geschlechter, in der Arbeitsamkeit, wodurch wir erhalten werden, in der Tätigkeit, wodurch man für seinen Kreis, für die Ferne, für die Menschheit wirkt, und endlich in der Ordnung und Gestalt, womit ganze Gesellschaften und Staaten ihr Dasein umgeben und zum Abschlusse bringen. Darum haben alte und neue Dichter vielfach diese Gegenstände benützt, um ihre Dichtungen dem Mitgefühle naher und ferner Geschlechter anheim zu geben. Darum sieht der Menschenforscher, wohin er seinen Fuß setzt, überall nur dieses Gesetz allein, weil es das einzige Allgemeine, das einzige Erhaltende und nie Endende ist. Er sieht es eben so gut in der niedersten Hütte wie in dem höchsten Palaste, er sieht es in der Hingabe eines armen Weibes und in der ruhigen Todesverachtung des Helden für das Vaterland und die Menschheit. Es hat Bewegungen in dem menschlichen Geschlechte gegeben, wodurch den Gemütern eine Richtung nach einem Ziele hin eingeprägt worden ist, wodurch ganze Zeiträume auf die Dauer eine andere Gestalt gewonnen haben. Wenn in diesen Bewegungen das Gesetz der Gerechtigkeit und Sitte erkennbar ist, wenn sie von demselben eingeleitet und fortgeführt worden sind, so fühlen wir uns in der ganzen Menschheit erhoben, wir fühlen uns menschlich verallgemeinert, wir empfinden das Erhabene, wie es sich überall in die Seele senkt, wo durch unmeßbar große Kräfte in der Zeit oder im Raume auf ein gestaltvolles, vernunftgemäßes Ganzes zusammen gewirkt wird. Wenn aber in diesen Bewegungen das Gesetz des Rechtes und der Sitte nicht ersichtlich ist, wenn sie nach einseitigen und selbstsüchtigen Zwecken ringen, dann wendet sich der Menschenforscher, wie gewaltig und furchtbar sie auch sein mögen, mit Ekel von ihnen ab, und betrachtet sie als ein Kleines, als ein des Menschen Unwürdiges. So groß ist die Gewalt dieses Rechts- und Sittengesetzes, daß es überall, wo es immer bekämpft worden ist, doch endlich allezeit siegreich und herrlich aus dem Kampfe hervorgegangen ist. Ja wenn sogar der einzelne oder ganze Geschlechter für Recht und Sitte untergegangen sind, so fühlen wir sie nicht als besiegt, wir fühlen sie als triumphierend, in unser Mitleid mischt sich ein Jauchzen und Entzücken, weil das Ganze höher steht als der Teil, weil das Gute größer ist als der Tod, wir sagen da, wir empfinden das Tragische, und werden mit Schauern in den reineren Äther des Sittengesetzes emporgehoben. Wenn wir die Menschheit in der Geschichte wie einen ruhigen Silberstrom einem großen, ewigen Ziele entgegen gehen sehen, so empfinden wir das Erhabene, das vorzugsweise Epische. Aber wie gewaltig und in großen Zügen auch das Tragische und Epische wirken, wie ausgezeichnete Hebel sie auch in der Kunst sind, so sind es hauptsächlich doch immer die gewöhnlichen, alltäglichen, in Unzahl wiederkehrenden Handlungen der Menschen, in denen dieses Gesetz am sichersten als Schwerpunkt liegt, weil diese Handlungen die dauernden, die gründenden sind, gleichsam die Millionen Wurzelfasern des Baumes des Lebens. So wie in der Natur die allgemeinen Gesetze still und unaufhörlich wirken, und das Auffällige nur eine einzelne Äußerung dieser Gesetze ist, so wirkt das Sittengesetz still und seelenbelebend durch den unendlichen Verkehr der Menschen mit Menschen, und die Wunder des Augenblickes bei vorgefallenen Taten sind nur kleine Merkmale dieser allgemeinen Kraft. So ist dieses Gesetz, so wie das der Natur das welterhaltende ist, das menschenerhaltende.

Bilder: William-Adolphe Bouguereau: L’Art et la Littérature, 1867, Arnot Art Museum, Elmira, New York State;
Frère et sœur, 1887;
Idylle Enfantine, 1900, Denver Art Museum, Colorado.
Soundtrack: Mozart, Stifters favorisierter Tonsetzer: Sinfonia concertante für Violine und Viola Es-Dur, KV 364, mit Vilde Frang und Nils Mönkemeyer an Solo-Violine und -Bratsche — weil die Nordmanntanne Vilde Frang, dieser grundmädchenhafte boreale Jeanstyp junonischer Statur, zu den paar Star-Geigerinnen zählt, mit denen man sich mal einen Kneipenabend lang abgeben möchte. Falls sie mitzieht.
Hochwaldklangwolke: Die einzelnen Minuten, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen
Update zu Zeichenstifter und
Ach Himmel, wie sich die Menschen täuschen können!:
Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, daß ich nur das Kleine bilde, und daß meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien.
A. S.: Bunte Steine, Vorrede, 1853.
Um Gottes willen, ich muss aufhören, Adalbert Stifter zu lesen. Ich geliere ja schon.

Es ist in jeder Hinsicht beruhigend, wenn Adalbert Stifter zu einem kommt. Da hat man richtig lange was zu lesen und muss sich nicht aufregen. Der Mann ist einer der verrufensten Großlangweiler der deutschen, wenn nicht gar der Weltliteratur, man liest ihn nicht atemlos. Er ist langatmig, weil er einen langen Atem hat. Deshalb braucht man einen langen Atem, um auch nur eine Geschichte von ihm, die natürlich als Erzählungen firmieren, bis zu Ende zu lesen. Man soll ihm sehr lange sehr genau zuhören, denn er will ausreden. Deshalb hat er seine meisten Erzählungen und Romane mindestens zweimal, gern auch gleich sechsmal, von Grund auf neu geschrieben.
Die gar nicht überschätzbare politische Dimension von Stifters dröhnender Stille hat Heribert Prantl erfasst: Was man vom langweiligsten aller langweiligen Dichter lernen kann, Prantls Blick vom 21. Januar 2018. Weil Prantl bei der Süddeutschen Zeitung eben nicht fürs Feuilleton, sondern ressortleitend fürs Innenpolitische zuständig ist, hat er weniger eigene Erkenntnisse gefunden, als er Autoritäten zitiert, denen er zu glauben geneigt ist: Christian Begemann mit:
„Im Zeitalter einer rasanten Beschleunigung aller Lebensvollzüge kann man den Nachsommer genießen als eine Art therapeutischen Entschleuniger, man kann ihn lesen als … den ersten ökologischen Roman.“ Das Vorbildhafte der kleinen Stifterwelt zeige sich nicht in bedeutenden Ereignissen und umfassenden Plänen, sondern gerade im schlichten, aber völlig durchgearbeiteten Alltäglichen; für Stifter sei es immer das Kleine, in dem sich das Richtige realisiert.
Karl Kraus
verbeugte sich tief vor Adalbert Stifter — hielt dagegen die meisten Schreiber seiner Zeit für völlig bedeutungslos; er forderte sie auf, (sofern sie noch „ein Quäntchen Menschenwürde und Ehrgefühl“ besäßen) vor das Grab Adalbert Stifters zu ziehen. Sie sollten dort „das stumme Andenken dieses Heiligen für ihr lautes Dasein um Verzeihung bitten und hierauf einen solidarischen leiblichen Selbstmord auf dem angezündeten Stoß ihrer schmutzigen Papiere und Federstiele unternehmen“.
Simon Strauß meine:
[b]ei Stifter sei nichts zu klein, um von ihm nicht groß beschrieben zu werden. Bei Stifter lernt man, was Stille ist: Es gibt eine Stille, in der man meint, „man müsse die einzelnen Minuten hören, wie sie in den Ozean der Ewigkeit hinuntertropfen“. Man fände diese Stille gern in unseren lauten Tagen.
und Prantls alter Lehrer, „über den wir Schüler auch deswegen gefeixt haben, weil er bei jeder Gelegenheit Stifter zitierte; am liebsten einen Satz aus dem Beginn der Erzählung ‚Hochwald‘.“
Autoritäten zu zitieren ist etwas Zulässiges und Glaubwürdiges; ich unternehme wenig anderes. Prantl hat es anlässlich Stifters 150. Todestag am 28. Januar 2018 getan. Typisch, dass daran ein 64-jähriger Fusselbart in seiner regelmäßig vom Lektorat durchgewinkten Nebenkolumne erinnern muss und sich der deutschsprachige Kulturbetrieb (dich schau ich an, Buchhandel!) dazu verhalten hat wie „tiefschwarz, überragt von der Stirne und Braue der Felsen, gesäumt von der Wimper dunkler Tannen, drin das Wasser regungslos wie eine versteinerte Träne“ (Stifter, Hochwald, 1842).

Das wichtigste Handlungselement, zugleich turbulenteste Ereignis, ist so ziemlich jedes Mal, wie grün der Wald ist. Meistens ist es der Böhmerwald, und davon der südliche Teil, im heutigen Länderdreieck Bayern-Böhmen-Oberösterreich, wo sie Mühlviertel dazu sagen. Die Eichendorff-Novellen sind Tarantino-Blockbuster dagegen.
Arno Schmidt hatte also recht wie immer, indem er Stifter ausführlicher, tiefgreifender und detaillierter, also schon nicht mehr lässlicher Plagiate bei James Fenimore Cooper überführt hat, und begründet fundiert, welche von Stifters Leistungen überleben werden und welche seiner Belanglosigkeiten lieber in der Literaturgeschichte verstauben dürfen. Stifters Wald aber schafft das Grünsein im Buch so gut wie im Film, und das ist durchaus eine Qualität. Gerade über die Studien-Sammlung, worin der Hochwald vorkommt, redet Meister Arno recht lobend; zu meiden wäre das Großwerk Witiko.

So respektlos das alles klingt, fühlt man sich nach einigem Vertiefen in Stifteriana richtig ausgeruht. Deshalb hab ich lang und breit nachgegoogelt, wo Stifters Handlungen sich überhaupt ereignen. Nicht dass es besonders schwer herauszufinden wäre, aber man verweilt dann doch gar zu gern.
Es ist alles ums Dreiländereck Böhmen-Österreich-Bayern voll der fleischfressenden, weil deutsch und tschechisch vorhandenen Ortsnamen und viel Vollprovinz zum Kennenlernen, Einordnen und geistigen Rumhängen. In meiner Kindheit war unter den Eisenbahnerkollegen meines Vaters das anliegende Steinerne Meer bekannt — und beliebt, um zollfrei Schnaps und Zigaretten anzukaufen. Die Gesamtgegend heißt Mühlviertel — ja, sag das doch gleich, das kennt man dem Namen nach auch weiter nördlich, als Ausdruck für beschaulichen Urwald mit nicht minder uriger Bevölkerung — also weniger als Kulturgegend, in der man der von Fenimore „Lederstrumpf“ Cooper … nun ja: entlehnten Weltliteratur hinterherspüren könnte.
Als Stichwortgeber und Ausgangspunkt für Intenet-Reisen empfiehlt sich das Böhmerwälder Adalbert-Stifter-Denkmal, von dort geht’s weiter in die ganze Gegend mit Plöckensteiner See und smetanabekannter Moldauquelle.
Es herrscht ein naturgemäß sehr ruhiger, dafür umso länger andauernder Gelehrtenstreit darüber, welche Fassungen aus Stifters Werk vorzuziehen seien: Die Frühfassungen gelten als unmittelbar und frisch, aber unausgegoren, die Spätfassungen als ausgereift, aber breitärschig. In neueren Stifter-Ausgaben stelle ich eine Tendenz zu den Frühfassungen fest und bin recht glücklich mit meinen angemessen durchgegilbten Studien „nach dem Text der Erstdrucke oder der Ausgabe letzter Hand“ aus der fünfbändigen Winkler-Gesamtausgabe, die meines Wissens seit 1949 unverändert aufgelegt wird. Für meine eigenen privaten Studienpläne möchte ich festhalten, dass bis jetzt gelesen sind: Der Condor, Die Mappe meines Urgroßvaters, Brigitta, Der Waldsteig und sowieso Der Hochwald; Der Nachsommer ist anstehend, aber vorsichtshalber nicht zu bald, Witiko wird weiträumig umfahren und um zu wissen, wie überstrapaziert der Bergkristall ist, muss man nicht mal die 2004er Vilsmaier-Verfilmung mit Katja Riemann kennen.

Am besten und am nachhaltigsten wirksam war mir der Hochwald. Kann sein, weil ich von Anfang an immer die Stimmung aus dem Klangwolken-Trailer mithören konnte und ja mit Sommerregen, tiefem grünem Wald, Moos und barfüßigen Dryaden im Elfenkleide etwas anfangen kann.
Klangwolke? — Klangwolke. Offenbar brauchten engagierte Kulturschaffende in Österreich keinen 150. Todestag, denen genügte der 210. Geburtstag:
——— lawine torrèn:
HOCHWALD
Trailer für Linzer Klangwolke, 2015:
adalbert stifters erzählung HOCHWALD als stadtergreifendes naturtheater vom paradies und seinem verlust
ein vater aus dem böhmerwald fürchtet während eines krieges um die sicherheit seiner beiden töchter und bringt sie deshalb in ein verstecktes waldhaus. dieses haus befindet sich im unberührten wald. dennoch wird das versteck von einem jungen mann entdeckt, der eines der mädchen liebt.
vor dem hintergrund dieser erzählung über den wald, die unschuld und das streben nach sicherheit, geht es um die zukunft der natur. „während wir uns über die entwicklung der städte im 21. jahrhundert gedanken machen, fehlt ein gestalterischer plan dafür, wie sich jene naturlandschaft entwickeln sollte, die längst nicht mehr unabhängig vom menschen dahinwächst. aller wald in europa ist von menschenhand gemacht. wie also stellen wir in hinkunft die natur her, sodass es sich lohnt in ihr zu wohnen?“ so regisseur hubert lepka. anders gesagt: der böhmerwald ist heute bedeckt von wirtschaftswald. wahre baumriesen und gestaltete natur finden wir hingegen in den städtischen parks und den englischen gärten.
der wald kommt in die stadt
die textfassung von joey wimplinger übersetzt die romantische erzählung stifters von 1842 in das urbane landschafts- und stadtbild von linz an der donau. da weder die donau noch die bauten der stadt in den wald kommen, kommt der wald in die stadt. bagger, stapler, laster und schiffe bringen mehrere dutzend bäume — einen veritablen nadelwald — samt waldhaus in einer überdimensionalen choreographie zum tanzen. die donaulände und der gesamte sichtbare stadtraum werden als bewegte naturlandschaft begreifbar, über der zart an einem abrissbagger ein beflügeltes wesen schwebt.
feuer
vieles von dem, wie stadt aussieht (die mittelalterliche stadt genauso wie die moderne), hat mit dem feuer zu tun. brände machten bauordnungen nötig. brandrodungen gestalteten wald und wiese. vom brennmaterial holz wurden ganze landschaften geprägt. feuer und seine abwehr bestimmen immer noch unser wohnen. auch in dieser klangwolke kommt also dem feuerwerk und der feuerwehr eine entsprechende rolle zu.
klangwolke unplugged
adalbert stifters HOCHWALD spielt im 30-jahrigen krieg, jenem umbruch in europa, der die religion, die geographie der herrschaft, die musik, die kunst ebenso zerstörte wie neu entstehen ließ. das im klingenden spiel marschierende heer (jenes der bauern wie jenes der fürsten) lebt heute noch in der tradition der blasmusik fort. HOCHWALD bringt marschmusik und die hochentwickelte polyphonie der spätrenaissance in den kontext zeitgenössischer elektronik. und zwar als musikdramatik im sinne von erzählender, emotionalisierender filmmusik.
pavillon
ein haus fährt auf dem treppelweg, ein offener pavillon auf rädern, dessen innenwände aus großen videowalls bestehen. unmittelbar vor den augen der zuschauer gleiten darin wichtige szenen von HOCHWALD vorbei.
die idee dieser mobilen immobilie weist vielleicht einen architektonischen weg, wie wir bei schonendem verbrauch der grundstoffe, wie etwa landschaft, baumaterial und energie, unsere lebenswelt so gestalten konnten, dass es sich auch in hinkunft lohnt, darin zu wohnen.
HOCHWALD
tanz der bäume im donaupark
5. september 2015 | 19.30 Uhr
linz | donaupark | klangwolke
Für ein „stadtergreifendes Naturtheater“, das man offenbar wenn schon nicht gesehen, so anscheinend doch einmal gemacht haben muss, geht so ein Projekt schon klar. Österreicher dürfen sowieso alles, und Österreicherinnen erst.
Das Theater ist nicht vollständig im Bild überliefert, im Trailer 2 beobachten wir eine barfüßige Österreicherin und dürfen fachmännisch rätseln, ob die Schauspielerin in den tschechischen Reiterstiebeln dieselbe wie die Barfüßerin war, und wenn ja, ob sie zuerst die gestiefelten Szenen drehen durfte oder gleich zu Drehbeginn barfuß durch den Wald sprinten musste. Passend ist das insofern, als auch im Stifterschen Hochwald zwei einander ähnelnde, weil schwesterliche Jungmaiden vorkommen, die noch tiefer in den Wald verschickt werden, als sie zu Anfang schon waren, und barfüßicht vorzustellen sind. Die Nahaufnahme der Waldfeenflossen ab Minute 1:35 im Trailer vermittelt wohl die archaische Naturnähe.
Im Trailer 3 verwendet die österreichische lawine für ihre Aspekte des Balletts allerschwerstes land- und forstwirtschaftliches Gerät, ja gar Hubschrauber. Wenn das Herr Stifter noch hätte erleben müssen, wäre er schon gar nicht mehr mit 62 so ausgesprochen unglücklich beim Rasieren mit dem Messer ausgerutscht, indem ihn umgehend der Schlag getroffen hätte, weil es seiner umfassenden Ruhe des sanften Gesetzes widerspricht — es kann aber ein Ballett schon wieder auf spektakuläre Weise cool machen:
Ich muss aufhören, Adalbert Stifter zu lesen. Vielleicht versuch ich doch mal Wilhelm Raabe.

Bilder: Adalbert Stifter: Das malerische Werk:
- Die Ruine Wittinghausen, um 1833–1835, Öl auf Leinwand, 905 cm × 14,2 cm (sic, laut Zeno.org);
- St. Thoma Wittinghausen, um 1839, Öl auf Holz, 9,5 cm × 14,2 cm, Adalbert-Stifter-Institut des Landes Österreich;
- Zerfallene Hütte im Wald, 1840 oder 1846, Bleistift auf Papier, 19 cm × 26,5 cm;
- Die Gutwasserkapelle bei Oberplan, 1845, Bleistift auf Papier, 24,4 cm × 29,6 cm;
- Waldhang, 2. Oktober 1865, Bleistift auf Papier, Adalbert-Stifter-Institut des Landes Österreich;
- Christoph K.: Böhmerwald — Blick ins Landesinnere von Tschechien, 10. Oktober 2011:
Blick vom Plöckenstein (am Adalbert-Stifter-Denkmal) in Richtung Landesinneres der Tschechischen Republik. In der Bildmitte am Horizont ist das Kernkraftwerk Temelín erkennbar.

Soundtrack: Andreas Hartauer aus Goldbrunn/Zlatá Studna, um 1870: Tief drin im Böhmerwald, mit Bildmaterial aus Stifter-Hochwald-City Böhmisch Krumau an der Moldau, das ist: Krumlov. Aufnahme von Oliver Nowak an Mandoline und Gitarre in Limerick, County Limerick, Irland, 2016:
Dem Knaben graut im Haidekraut
Update zu Ho, ho, meine arme Seele!:
Es lässt sich leider nicht in Abrede stellen, dass Forscher, welche sich mit zahlreichen Fragen beschäftigen, die besonders die Hochmoore stellen, schon jetzt im nordwestdeutschen Tieflande, einem der Moorreichsten Länder der Erde, sich vergeblich um deren Lösung bemühen. In wenigen Jahren wird dies überhaupt nicht mehr möglich sein, bei der Hast, mit der man bemüht ist, die letzte Spur der Natur auf diesen interessanten Bildungen der Nützlichkeit zu opfern.
Carl Albert Weber, 1901.

Wie versprochen verlautet nachstehend das Gedicht vom Haidemesser, das aller Wahrscheinlichkeit nach die Freiin Annette von Droste-Hülshoff im November 1841 zu ihrem Der Knabe im Moor angeregt hat.
Um bei dieser Gelegenheit der Frage eines nicht gerade minderbemittelten, nur eben mit anderen Sachen beschäftigten Kollegen zu begegnen: Doch, ja, wirklich, solche Interferenzen lassen sich schlüssig begründen und nachweisen; und: nein, nicht mit allerletzter, unwiderlegbarer Sicherheit. Leider zählt die Literaturwissenschaft „nur“ unter die Geisteswissenschaften, die nicht alles durch Empirie beweisen können, aber keineswegs bei beliebig austauschbaren Assoziationen und Vermutungen verweilen. Deshalb bleiben sie weiterhin Wissenschaften, weil sie auf logischen Wegen zu Ergebnissen kommen. Woraus ich betonen möchte: auf logischen Wegen; daran muss man oft auch die Literaturwissenschaftler selbst erinnern. Aber das funktioniert, und es funktioniert wissenschaftlich durch Deduktion und Induktion.
Der schlüssige Nachweis von dem apokryphen Gedicht Der Haidemesser von einem anonym bleibenden „B.H.“ auf Der Knabe im Moor geht so: Der Haidemesser stand am 18. Dezember 1837 im Unterhaltungsblatt des Westfälischen Merkur, den sich die Droste bis auf Schloss Meersburg am Bodensee liefern ließ — weil sie ihr angekauftes Fürstenhäusle krankheitshalber von ihrer Schwester und Schlossherrin verwalten lassen musste. was sie leider nicht mehr überleben sollte.
Nach der anderen Richtung — zurück in die Vergangenheit, auf die Quelle zu — reicht Der Haidemesser inhaltlich an das Gedicht Der Heidemann von Wilhelm Junkmann von 1836. Mit Junkmann war die Droste persönlich bekannt, kurz nach dem Knaben im Moor schrieb sie 1842 ihrerseits eine eigene Version gleichen Namens.
Zu den Handlungsmotiven bei B.H., Junkmann und Droste-Hülshoff: Auch bei der Droste — wie übrigens schon im alles andere als vorbildlosen Erlkönig von Goethe 1782 — flieht ein Knabe vor dem versammelten Volksaberglauben, den die Droste 1845 noch in Gestalten der Sonntagsspinnerin, des diebischen Torfgräbers und des kopflosen Geigers in den Westphälischen Schilderungen ausbreiten sollte. Darüber hinaus sollten dem eingesessenen Westfalen Moorlandschaften geistig sehr viel näher liegen als anderen Ethnien: sind im heutigen Nordrhein-Westfalen doch in Zeiten der Entwässerung bis heute auffallend viele Moore erhalten. Für die Empiriker unter uns sind das Zufälle, deren Logik nicht eindeutig zwingend sein kann, für Literaturwissenschaftler sind es Zufälle, die sich nicht mehr ignorieren lassen.

Im Falle der Droste erfährt man diese Herleitung aus ihrer Gesamtausgabe von Bodo Plachta und Winfried Woesler — zwei Bände, Deutscher Klassiker Verlag, als wohlfeilere Hardcovers bei Insel — die ihren Kommentar offenbar sehr direkt aus der großen Gedichtinterpretation von Hermann Kunisch bezieht: In Annette von Droste-Hülshoff: ‚Der Knabe im Moor‘ in: Kleine Schriften. Zweiter Teil: Zur neueren deutschen Literatur, Duncker & Humblot, Berlin 1968, Seite 303 bis 337 steht in allen Wortsinnen erschöpfend alles zusammengetragen, was es zu Geschichte, Deutung und Bedeutung der Drosteschen Ballade zu wissen gibt — diese 35 Seiten der „Kleinen Schrift“ sind das einschlägige Standardwerk. Zur Erschließung der Quellen heißt es dort — wertend genug:
Die bisherige Beschreibung und Auslegung des ‚Knaben im Moor‘ kann in ihrem Gewicht verstärkt werden, wenn wir neben dieses Gedicht ein im Thema verwandtes eines münsterländischen Heimatpoeten stellen. Julius Schwering hat in seiner für die Klärung der Dichtung Annettes noch immer wichtigen Ausgabe [] ein Gedicht eine unbekannten (B. H. unterzeichnet) mitgeteilt, das im Unterhaltungsblatt des ‚Westfälischen Merkur‘ vom 18. 12. 1837 erschienen ist. Schwering vermutet, daß die Dichterin dieses Machwerk gekannt habe und von ihm zu ihrem angeregt worden sei. Das ist sicher zutreffend. Nur darf man darüber hinaus sagen, daß Widerspruch gegen dieses Erzeugnis, in dem ein großartiger Vorwurf kläglich vertan worden war, sie zu ihrem Gedicht veranlaßt haben kann. Jedenfalls ist das Gedicht aus dem ‚Westfälischen Merkur‘ geeignet, den Rang der Drosteschen Balle in volles Licht zu rücken.
Ein Machwerk also, das einen großartigen Vorwurf kläglich vertut. Die Leistung der Droste wäre demnach, aus Widerspruchsgeist eine regionale Gespenstergeschichte in der Tradition des Erlkönigs verbessert zu haben; die Leistung der heute gut erreichbaren Gesamtausgabe, das „Machwerk“ im Gegensatz zu Hermann Kunisch in originaler Rechtschreibung anzuführen. Die Typographie der Zeileneinrückungen entnehme ich dagegen nur dem Kunisch:

——— B. H.:
Der Haidemesser
Unterhaltungsblatt des Westfälischen Merkur, 18. Dezember 1837:
Der Süd durchfleucht
Die Haide feucht,
In himmlischer Ferne
Erblassen die Sterne,
Es eilet der Knabe: O wär ich zu Haus!
Da ist es warm, da wird mir nicht graus!“Dem Knaben graut
Im Haidekraut,
Da glühet es helle
Von Stelle zu Stelle,
Da zittert das kraut, da risselt der Schilf.
Der Knabe rufet: „Mein Vater, o hilf!“Der Knabe flieht
Durch Kraut und Riet,
Und stürzt in die Hütte
Mit bebendem Schritte,
Da athmet er frei, da wehet es warm.
„Was bist du so blaß? Komm, ruh‘ mir im Arm!“Ach, ach, mir graut‘
Im Haidekraut,
Da glüht es so helle
Von Stelle zu Stelle,
Da zittert das Kraut, da risselt der Schilf.
Ich rief vor Schrecken: „Mein Vater, o hlf!“„Mein Kind, das ist
Der böse Christ,
Durchwandelt die Haide
In Trauer und Leide
Mit dürrem Fuße bei nächtlichem Graun.
Und öfter noch wirst du im Sturm ihn schaun.Der Mann war schlecht,
Er maß nicht recht,
D’rum mißt er die Stätte
Mit glühender Kette
Von Alters her bis zum Ende der Welt.
Thu‘ immer, mein Söhnchen, was Gott gefällt!“

Knäbin im Moor: Martin Peterdamm, Berlin: Lost in the Swamp, 1. April 2017. Nach neuerer spontaner Auskunft des Fotografen selbst entstand die Serie an einem der brandenburgischen Moore: dem Moor um den Teufelssee, nahe dem Müggelsee, den Zeitstempeln nach zwischen 18.02 und 18.45 Uhr.

Soundtrack: Kate Bush: Wuthering Heights, aus: The Kick Inside, 1978: „Out on the wiley, windy moors, we’d roll and fall in green“, der Jugend zur Warnung:
Bonus Track: das gleiche nochmal von The Ukulele Orchestra of Great Britain, aus: A Fist Full of Ukuleles, 1994, weil Musik ja ruhig auch Spaß machen darf:
Ho, ho, meine arme Seele!
Update zu Denkst du denn nicht an den Loup Garou?,
Oh my, oh my, oh my, what if it was true? (O wolle nicht ergründen, was einmal unergründlich ist)
und Ach! wie ists erhebend sich zu freuen:
Es ergeht Empfehlung, ausnahmsweise fürs Fernsehen:
Jan Haft hat bis 2015 für Magie der Moore 500 Drehtage auf fünf Jahre und 80 Drehorte verteilt; der technische Aufwand lässt sich natürlich schon in Zahlen ermessen, sagt aber noch lange nichts aus über die Wunder, um nicht zu sagen: das Wunder dieses Dokumentarfilms.
 Dokumentarfilm. Wie das klingt. Nach Terra X mit Wumpf-Wumpf-Untermalung von lizenzfrei schaffenden Hans-Zimmer-Epigonen — wie sie auch der Trailer noch bringt. Erwarten Sie nichts und erwarten Sie alles. Wenn Sie das Ereignis, wie es leider wahrscheinlich ist, auf Arte verpasst haben, muss eben jetzt die DVD her, aber wahrscheinlich wurde genau dafür die Blu-ray erfunden. Beide werden offenbar extra erschwinglich gehalten, weil sie ausdrücklich als Unterrichtsmaterial ab der 5. Klasse herhalten sollen — Freigabe ohne Altersbeschränkung — und zwar vorzugsweise für Deutsch, Biologie, Erdkunde und Kunst. So geht interdisziplinär. Und: Nein, einfach so auf YouTube steht’s nicht.
Dokumentarfilm. Wie das klingt. Nach Terra X mit Wumpf-Wumpf-Untermalung von lizenzfrei schaffenden Hans-Zimmer-Epigonen — wie sie auch der Trailer noch bringt. Erwarten Sie nichts und erwarten Sie alles. Wenn Sie das Ereignis, wie es leider wahrscheinlich ist, auf Arte verpasst haben, muss eben jetzt die DVD her, aber wahrscheinlich wurde genau dafür die Blu-ray erfunden. Beide werden offenbar extra erschwinglich gehalten, weil sie ausdrücklich als Unterrichtsmaterial ab der 5. Klasse herhalten sollen — Freigabe ohne Altersbeschränkung — und zwar vorzugsweise für Deutsch, Biologie, Erdkunde und Kunst. So geht interdisziplinär. Und: Nein, einfach so auf YouTube steht’s nicht.
Zu Jan Hafts interdisziplinärem Vorgehen gehört es, ausführlich an geeigneten Stellen zum Gestalten seiner Stimmung ein Gedicht heranzuziehen, das wir in unserer leider allzu monofakultären Sichtweise — mit Verlaubnis — nicht mit dem Arsch anschauen würden, weil es zu bekannt und auch ohne uns schon viel zu gut belegt ist: Der Knabe im Moor von der Droste 1842.
In der Verbindung zu Hafts ganz und gar erstaunlichen Bildern, die man so nicht hat kommen sehen, erhellt plötzlich, wie schön das Gedicht eigentlich ist — schauen Sie zum Beispiel mal das durchtriebene Reimschema genau an. Wir müssen deshalb gar nicht so elitär tun, sondern als Erkenntnisgewinn mitnehmen, was sich anbietet: 1. Die Droste hatte für ihre Interpretation einer Moorbegehung ein recht eindeutig fassbares Vorbild: einen nicht näher bezeichneten „B.H.“, der am 18. Dezember 1837 ins Unterhaltungsblatt des Westfälischen Merkur ein Gedicht namens Der Haidemesser setzen ließ, das möglicherweise auf Der Heidemann von Wilhelm Junkmann 1836 zurückgeht, welche beiden im Gegensatz zur Droste praktisch gar nicht belegt werden. Den Apokryphen vom Haidemesser will ich demnächst an dieser Stelle ausbreiten, was ich für diesen Fall ausnahmsweise versprechen kann (und wofür sich Ostern aufdrängt); 2. „Scheide“ bedeutet, liebe pubertäre Unterrichtsteilnehmer ab der 5. Klasse, die Grenze zwischen Moor und festem Boden.
Es folgt die zeichengenaue Fassung nach dem Erstdruck.

——— Annette von Droste-Hülshoff:
Der Knabe im Moor
geschrieben November 1841 im Fürstenhäusle zu Meersburg am Bodensee,
aus: Morgenblatt für gebildete Stände Nr. 40, 16. Februar 1842,
in: Gedichte, 1844, Abschnitt Heidebilder;
Levin Schücking (Hrsg.): Gesammelte Schriften von Annette Freiin von Droste-Hülshoff.
Band 1: Lyrische Gedichte, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart 1879, Seite 115–116:
O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Haiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt –
O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche!
Fest hält die Fibel das zitternde Kind
Und rennt, als ob man es jage;
Hohl über die Fläche sauset der Wind –
Was raschelt drüben am Hage?
Das ist der gespenstige Gräberknecht,
Der dem Meister die besten Torfe verzecht;
Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind!
Hinducket das Knäblein zage.Vom Ufer starret Gestumpf hervor,
Unheimlich nicket die Föhre,
Der Knabe rennt, gespannt das Ohr,
Durch Riesenhalme wie Speere;
Und wie es rieselt und knittert darin!
Das ist die unselige Spinnerin,
Das ist die gebannte Spinnlenor‘,
Die den Haspel dreht im Geröhre!Voran, voran, nur immer im Lauf,
Voran, als woll‘ es ihn holen;
Vor seinem Fuße brodelt es auf,
Es pfeift ihm unter den Sohlen
Wie eine gespenstige Melodei;
Das ist der Geigenmann ungetreu,
Das ist der diebische Fiedler Knauf,
Der den Hochzeitheller gestohlen!Da birst das Moor, ein Seufzer geht
Hervor aus der klaffenden Höhle;
Weh, weh, da ruft die verdammte Margret:
„Ho, ho, meine arme Seele!“
Der Knabe springt wie ein wundes Reh,
Wär‘ nicht Schutzengel in seiner Näh‘,
Seine bleichenden Knöchelchen fände spät
Ein Gräber im Moorgeschwehle.Da mählich gründet der Boden sich,
Und drüben, neben der Weide,
Die Lampe flimmert so heimathlich,
Der Knabe steht an der Scheide.
Tief athmet er auf, zum Moor zurück
Noch immer wirft er den scheuen Blick:
Ja, im Geröhre war’s fürchterlich,
O, schaurig war’s in der Haide!
Jan Haft könnten wir an dieser Stelle noch öfter gebrauchen. Noch vor seinem — nicht seinem ersten — wundersamen Meisterwerk über Moore 2015 hat er nämlich Das Grüne Wunder – Unser Wald 2012 gedreht, in sechs Jahren an 70 Drehorten, als Unterrichtsmaterial empfohlen für Deutsch, Heimat- und Sachkunde, Erdkunde, Kunst und Werken: noch viel interdisziplinärer, und sobald es um Wälder geht, bestimmt noch viel wundersamer. Auch der steht nicht einfach so auf YouTube, aber die DVD ist lieferbar.

Bilder: Deutscher Balladenborn für jung und alt, 1904,
via Martina „Büchersammler“ Berg, 16. September 2013;
T. Finn: Moor, Germany, 2015, via Low on Clichés:
Torfstich. Torfabbau zu Heizzwecken vor 1900 und nach 1918 bis Ende der 20er Jahre. Geringfügiger Abbau von 1945–1946 (Abstichkante von 1946 nch sichtbar). Stichfläche wird in zunehmendem Maße von Hochmoorpflanzen besiedelt.

Rezitation: Sigrid Carpe Poem aus Regensburg, 4. Januar 2015;
Vertonung: Sturmpercht: Der Knabe im Moor, aus: Geister Im Waldgebirg, 2006,
mit abweichendem Text, aber schmissigem Gitarrenzupf;
Bonus Track: Various Irish Musicians: The Gathering, 1981, opening mit Paul Brady: Heather on the Moor:
Nachtstück 0012: Wie es enden wird, vermag ein irdischer Verstand nicht zu ergründen
Update zu Damals gab es keine:
——— Adalbert Stifter:
Der Nachsommer
Kapitel Das Fest, 1857:
Wie wird es sein, wenn wir mit der Schnelligkeit des Blitzes Nachrichten über die ganze Erde werden verbreiten können, wenn wir selber mit großer Geschwindigkeit und in kurzer Zeit an die verschiedensten Stellen der Erde werden gelangen, und wenn wir mit gleicher Schnelligkeit große Lasten werden befördern können? Werden die Güter der Erde da nicht durch die Möglichkeit des leichten Austauschens gemeinsam werden, daß allen alles zugänglich ist? Jetzt kann sich eine kleine Landstadt und ihre Umgebung mit dem, was sie hat, was sie ist, und was sie weiß, absperren, bald wird es aber nicht mehr so sein, sie wird in den allgemeinen Verkehr gerissen werden. Dann wird, um der Allberührung genügen zu können, das, was der Geringste wissen und können muß, um vieles größer sein als jetzt. Die Staaten, die durch Entwicklung des Verstandes und durch Bildung sich dieses Wissen zuerst erwerben, werden an Reichtum, an Macht und Glanz vorausschreiten und die andern sogar in Frage stellen können. Welche Umgestaltungen wird aber erst auch der Geist in seinem ganzen Wesen erlangen? Diese Wirkung ist bei weitem die wichtigste. Der Kampf in dieser Richtung wird sich fortkämpfen, er ist entstanden, weil neue menschliche Verhältnisse eintraten, das Brausen, von welchem ich sprach, wird noch stärker werden, wie lange es dauern wird, welche Übel entstehen werden, vermag ich nicht zu sagen; aber es wird eine Abklärung folgen, die Übermacht des Stoffes wird vor dem Geiste, der endlich doch siegen wird, eine bloße Macht werden, die er gebraucht, und weil er einen neuen menschlichen Gewinn gemacht hat, wird eine Zeit der Größe kommen, die in der Geschichte noch nicht dagewesen ist. Ich glaube, daß so Stufen nach Stufen in Jahrtausenden erstiegen werden. Wie weit das geht, wie es werden, wie es enden wird, vermag ein irdischer Verstand nicht zu ergründen. Nur das scheint mir sicher, andere Zeiten und andere Fassungen des Lebens werden kommen, wie sehr auch das, was dem Geiste und Körper des Menschen als letzter Grund inne wohnt, beharren mag.
Anmerkung: Adalbert Stifter (gestorben am 28. Januar 1868) ist 23 Jahre älter als Jules Verne (geboren am 8. Februar 1828) — der meines Wissens nie das Internet „vorweggenommen“ hat. Aber sonst nächst Gott und Leonardo da Vinci so ziemlich alles.
Nachträglich angenehme Ruhe zum 150. Todestag, et mes félicitations au 190e anniversaire, maîtres.
Welche Umgestaltungen wird aber erst auch der Geist in seinem ganzen Wesen erlangen?: Rembrandt van Rijn: Die Nachtwache, 1642, Öl auf Leinwand, 363 cm × 437 cm, Rijksmuseum Amsterdam,
via The Adventures of Accordion Guy in the Twenty-First Century:
Nothing to see here…or is there?, 31. März 2015.
Soundtrack: Ajde Jano: The Story, 2017. Unterstützet auch Oliver Nowak an Mandoline, Gitarren, Saz und Moviemaker nebst King John, die miteinander Jack’s Compass bilden. Aufgenommen und filmed on location of Limerick, County Limerick, 2017. Die Moral stimmt immer:
Am deutschesteresteresten
Update zu Was zusammengehört
und Geibels Wesen und Beruf:
——— Friedrich Rückert:
Grammatische Deutschheit
in: Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1819. Neue Folge, erster Jahrgang 1819, Seite 400:
Neulich deutschten auf deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,
Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der deutscheste sey.
Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;
Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.
Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,
Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ.
„Ich bin deutscher als deutsch.“ „Ich deutscherer.“ „Deutschester bin ich.“
„Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.“
Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,
Deutschten sie auf bis zum — Deutschesteresteresten;
Bis sie vor comparativisch= und superlativischer Deutschung
Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.
Friedrich Rückert, den mag ich ja. Und jetzt bilde ich mir wunder was darauf ein, als erster im großen bunten Internet die Quelle mit der originalen Rechtschreibung ausfindig und zugänglich gemacht zu haben. Dankeschön.
Die Reinigung von allem „Undeutschen“ und „Unvolkstümlichen“ war zur Zeit der Napoleonischen Befreiungskriege 1813 bis 1815 zur Mode geworden; siehe auch: Friedrich Ludwig „Turnvater“ Jahn: Deutsches Volksthum, Abschnitt Achtung der Muttersprache, Niemann und Comp., Lübeck 1810.
Rückert, form- und inhaltsbewusst wie immer, hat seine Grammatische Deutschheit passend ins elegische Distichon gesetzt.
Bild: Johannes Sadeler I nach Hans von Aachen, Germania, aus der Serie „Quatuor Europae nationes“, 1594.
Kupferstich, 22 x 25,8 cm, München, Staatliche Graphische Sammlung
via Rainer Schoch im RDK Labor: Germania, 2014:
Nach Entwürfen von Hans von Aachen und mit Widmung an den Geographen Abraham Ortelius schufen Johannes und Raphael Sadeler 1594 die Kupferstichfolge der „Quatuor Europae nationes“: Italia, Germania, Francia und Hispania sind jeweils in einem Götterpaar personifiziert. Für Germania steht Ceres mit Krone und Szepter, umgeben von Gegenständen ihres Erfindungsreichtums: dem Pflug, der Uhr, dem Kupferstich, der Druckerpresse, dem Schießpulver und zahlreichen Waffen. Trotz der vielen kriegerischen Attribute ist ihr Bacchus als Gefährte zugeordnet; Zecher vor einem Wirtshaus im Hintergrund verweisen auf die Trinkfestigkeit der Deutschen. Germania verkörpert keinen politischen Nationalbegriff, sondern charakterisiert eine Kulturnation. Dieser allegorische Völkervergleich knüpft an die kulturgeographische Literatur des Humanismus an und fügt sich in den enzyklopädisch-allegorischen Kontext der niederländischen Bilderfolgen.
Klangspur: Die schönsten Soldatenlieder und Märsche, Sammlung von 2016:
Und weil ich Sie schlecht mit vier Stunden Marschmusik im Ohr sitzenlassen kann, 2:03 Minuten der urdeutschen Fertigkeit des Jodelns und dem Spielen mit Gegebenheiten der deutschen Sprache — im Walzertakt und in der entspanntesten Weise und einer Virtuosität, dass man ihm spontan dankbar die Hand schütteln möchte, im spätneuzeitlichen Bacchus-Tempel zum Schimmelwirt dargeboten vom ehemaligen deutsch-niederbayerischen Nationalbarden Fredl Fesl zwischen erfindungsreichen Deutschen, ihre Trinkfestigkeit demonstrierend, 1976:
Ach Himmel, wie sich die Menschen täuschen können!
Update zu Das kannst du, Knabe, nicht fassen,
Inwendig Ochsenfleisch, auswendig Kuhhaut! Und so einer will Kind Gottes sein!
und Der Arzt von Münster in Salzkotten:
This is a four hour song and it will go on and on,
A moment in time traveling on even if it is too long.
I don’t care, I love to share, I love to sing along.
I know you do too, feel the same way so come along.
Sing your song, it’s all that you have to do.Cat Power: Willie Deadwilder, aus: Speaking for Trees, 2004.

Waren schon Die Epigonen von Karl Leberecht Immermann nicht genug zu empfehlen, hab ich mir wieder ein neues Buch gekauft: den Münchhausen vom selbigen, und schau an, was nicht gut möglich erschien: Der ist tatsächlich noch besser.
Es ist ungefähr der angelsachsenhumorige und jedermanns (der was taugt) Vorbild Tristram Shandy auf dem Weg zum grundteutschen Jean Paul, also ungefähr die formalen und inhaltlichen Purzelbäume von Brentano in seinen irrwitzigsten Momenten. Die zeitgebundene Satire muss man stellenweise mühsam nachschlagen, wenn man durchaus jeden größenwahnsinnigen Duodezfürsten und zu Recht verklungenen Lesefutterproduzenten beim Namen festnageln will, aber grundsätzlich ist das nicht allein historisch zu würdigen, sondern eine Mordsgaudi.
Die Epigonen sind von 1836, der Münchhausen schon von 1839. Auf seiner Umstellung vom Dramatiker und Theatermann hat Immermann also alles gegeben. Die Epigonen hat er noch in seine Arbeit als Düsseldorfer Theaterleiter 1834 bis 1837 dazwischengeschoben, nach dem Scheitern seines neuartigen künstlerischen Konzepts und des Budgets gab er die Leitung an seinen Vorgänger, Ex-Förderer und jetzigen schlimmsten Gegner zurück und schrieb sich an einer Neuinterpretation von Münchhausen aus.
Die Fingerübung mit den etwa 800 Seiten Epigonen hat sich gelohnt, liest sich aber, um nichts Boshaftes zu sagen, etwas heterogen, wie eine Sammlung von mehreren — der Einteilung in „Bücher“ nach zu schließen — neun Kurzromanen; im Münchhausen jagt immer noch eine Handlung die andere, die Hauptfigur ist sogar einer großen, ernsteren Sozialstudie — Der Oberhof — mehr oder weniger untergeordnet, aber es klingt alles viel eher nach Absicht: einem übermütigen System, weil eine vor sich hin strömende Prosa das ohne Rücksicht auf Aktfolgen und Schauspielerauftritte in dankenswerter Biegsamkeit möglich macht.
Nach diesen zwei Geniewürfen hätte Immermann noch ein grandioser Erzähler werden können, leider starb er schon 1840 mit zarten 44 Jahren. Uns Heutigen erwächst daraus die schöne Gewissheit, dass man mit gerade mal zwei Büchern eine relevante Immermann-Auswahlausgabe beisammen hat: Die Theaterstücke sind eher Zeitdokument, und die Briefausgabe von Hanser ist für die Institutsbibliothek der Germanisten. Bei mir waren die Epigonen ein Oxfam-Fund, den ich aufgelesen hab, weil ich für drei Euro nie wieder zu einer perfekt erhaltenen Winkler-Dünndruckausgabe mit intaktem Lesebändchen komme, und die Hanser-Ausgabe Münchhausen von 1977 war gerade beim Medimops für 99 Cents da; selbst mit Versandporto reicht das nicht mal für den Cappuccino, den Sie im Café dazu schlürfen müssen. Es geht auch gratis auf Zeno, aber damit verschwenden Sie ja nicht meine Freizeit. Nur so am Rande: Hanser 1977 ist recht ausführlich kommentiert und erklärt — wegen der Duodezfürsten und verklungenen Lesefutterproduzenten.
Wie lang darf ein Weblog-Eintrag technisch eigentlich sein? Für 800 Druckseiten Immermann reicht’s nicht, oder? Wie bei meinen bisherigen Anpreisungen dieses vernachlässigten Meisters muss ich mich auf ein Kabinettstück beschränken: Nehmen wir das abgeschlossene Märchen Die Wunder im Spessart.
Es ist kein Volks-, sondern ein Kunstmärchen, also vom Autor erfunden, nicht im Grimmschen Sinne von einem anonymen Volksmund überliefert, und dient daher als Beispiel für seine eigene Erzählweise. Gewisse Einwände könnte ich gegen die Darstellung der sprechenden Tiere erheben, die sich zu teleologisch auf die Märchenhandlung beziehen, aber wir reden hier von 1839 und sind aus echten Volksmärchen weit Holzigeres gewohnt. Wirklich raffiniert sind die streng durchgezogene aristotelische Einheit von Zeit, Raum und Handlung — die dann doch hinterrücks unterlaufen wird, freuen Sie sich drauf — und die Moral, die mir in einem Märchen so noch nie vorgekommen ist.
Für ein Märchen lässt sich die Handlung außergewöhnlich genau eingrenzen: Auf jeden Fall spielt sie an einem 29. Juni, dem Peter-und-Pauls-Tag, zwischen 1248, als Albertus Magnus sein Lehramt an der Kölner Klosterschule aufnahm, und 1280, als er starb. — Der Ort der Handlung, das Waldstück im Spessart, liegt an einer alten Heerstraße, die offenbar seit Immermann von einer Autobahn überbügelt wurde — oder wird der Eichhall von historischen Fernwegen gekreuzt? Wenn jemand etwas weiß, steht die Kommentarfunktion Tag und Nacht weit offen.
Gesegneten Peter und Paul.
——— Karl Leberecht Immermann:
Die Wunder im Spessart.
Waldmährchen.
in: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken, 1839, Schluss des 5. Buches (von 8):
Bist du wohl schon, Lisbeth, an einem klaren Sonnenmorgen durch einen schönen Wald gegangen, zu dem der blaue Himmel durch die grünen Kronen einblickte, wo dich der Othem der Bäume wie ein Hauch Gottes anwehte und dein Fuß von den Spitzen der Gräser tausend blitzende Perlen streifte?
Wohl bin ich das, Oswald, erst noch neulich, als ich durch das Gebirg nach den Zinsen und Gülten ging. Es ist gar herrlich im grünen, frischen Wald; ich könnte Tagelang hindurchwandern, ohne einem Menschen zu begegnen, und fürchtete mich nicht. Der Rasen ist der Mantel Gottes, man ist von tausend Englein beschirmt, man stehe oder sitze darauf. Jetzt ein Hügel und dann eine Ecke; ich lief und lief, weil ich immer dachte, dahinter schwebe der Wundervogel mit blauen und rothen Schwingen und dem Goldkrönchen auf dem Haupte. Ich lief mich heiß und roth, und nicht müd; man wird nicht müde im Walde!
Und sahst du hinter Hügel und Hecke den Wundervogel nicht schweben, so standest du athmend still und hörtest weit, weit aus dem Eichenthal herauf den Schall der Axt, die Uhr des Forstes, die da ansagt, daß auch in solcher lieben Einöde dem Menschen seine Stunde rinne.
Oder weiterhin, Oswald, die freie Sicht den Hang hinauf zwischen dunkeln, runden Buchen und oben doch wieder der Kamm der Halde von hohen Stämmen beschlossen! Da weideten rothe Kühe und schwangen die Glöcklein, der Thau im Grase gab der Senkung im Sonnenlicht einen silbergrauen Schein, und die Schatten der Kühe und der Bäume spielten darauf Versteckens mit einander.
An einem solchen sonnenklaren Morgen begegneten vor vielen hundert Jahren zwei Jünglinge einander im Walde. Es war in dem großen Waldgebirge, der Spessart genannt, welches die Markscheide zwischen den lustigen rheinischen Gauen und dem gesegneten Frankenlande macht. Das ist dir ein Wald, liebe Lisbeth, der zehn Stunden in der Breite und zwanzig in der Länge, Ebenen und Berge, Thäler und Klüfte bedeckt.
Auf der großen Heerstraße, die querdurch vom Rheinlande nach Würzburg und Bamberg läuft, begegneten einander die Jünglinge. Der Eine kam von Abend, der Andere von Morgen. Ihre Thiere waren so verschieden als ihre Wege. Der vom Morgen saß auf einem gelben fröhlich tanzenden Rößlein und stolzirte gar stattlich im bunten Wappenrock unter rothem Sammetbarret, von welchem die Reiherfedern herabwallten; der vom Abend trug eine schwarze Kappe ohne Abzeichen, einen langen Schülermantel gleicher Farbe, und ritt auf einem bescheidenen Maulthiere.
Als der junge Ritter dem fahrenden Schüler sich auf Rosseslänge genähert hatte, hielt er seinen Gelben an, bot dem Andern freundlich die Zeit und sagte: Guter Gesell, ich wollte so eben absteigen und meinen Morgen-Imbiß halten. Da nun aber zur Minne, zum Spiele und zum Mahl Zwei gehören, wenn diese drei lustigen Dinge gehörig von Statten gehen sollen; so wollte ich Euch fragen, ob Ihr nicht auch absteigen und mein Partner seyn wollt? Eurem Grauen würde ein Maulvoll Gras nicht minder schmecken, als meinem Gelben. Der Tag wird heiß werden, und den Thieren ist einige Rast vonnöthen.
Der fahrende Schüler war mit dem Vorschlage zufrieden. Beide stiegen ab und setzten sich an der Straße auf dem wilden Thymian und Lavendel nieder, von welchem, wie sie sich setzten, eine ganze Wolke Wohlgeruchs emporstieg, und hundert Bienchen, die in ihrer Arbeit gestört wurden, sich summend erhoben. Ein Knapp, der mit einem schwerbeladenen Gaule dem jungen Ritter gefolgt war, nahm die beiden Thiere in Empfang, reichte seinem Herrn aus dem Schnappsack Flasche und Becher nebst Brod und Fleisch, kandarte die Thiere ab und ließ sie seitwärts vom Heerwege grasen.
Der fahrende Schüler faßte in die Seitentasche des Mantels, zog die Hand verdrießlich zurück und rief: O über meine ewige Zerstreuung! Hatte ich mir doch heute Morgen in der Herberge das Frühstück so sauber zurecht gelegt und eingewickelt, da muß mir etwas Anderes eingefallen seyn, und über diesen Gedanken habe ich meine Kost vergessen.
Wenn es weiter nichts ist, rief der junge Ritter, hier ist genug für Euch und mich! Er theilte Brod und Fleisch, schenkte den Becher voll und reichte Festes und Flüssiges dem Andern hin. Hiebei faßte er ihn schärfer in’s Auge, und so that der Andere auch, und da entfuhr ihnen Beiden ein Ausruf des Erstaunens. Seid Ihr nicht … Bist du nicht … riefen sie. Freilich bin ich der Konrad von Aufseß! rief der junge Ritter. Und ich Petrus von Stetten! der Andere. Sie umarmten einander und konnten sich vor Freude über dieses unvermuthete Wiedersehen kaum fassen.
Es waren Spielcameraden, die sich zufällig im grünen Spessart trafen. Die Väter hatten auch Freundschaft mit einander gehabt, die Söhne hatten zusammen Ball geschlagen, sich hundertmal des Tages gezankt und eben so oft versöhnt. Der junge Petrus war aber von jeher stiller und nachdenklicher gewesen als sein Gefährte, dem nichts im Kopfe sitzen blieb, als die Namen der Waffenstücke und des Reitzeugs. Endlich hatte Petrus dem Vater erklärt, er wolle gelahrt werden, und war gen Cöln gezogen, zu den Füßen des berühmten Albertus Magnus zu sitzen, der aller bekannten Wissenschaften Meister war, und von dem das Gerücht sagte, er sei auch in geheime Künste tief eingeweiht.
Eine geraume Zeit verfloß seitdem, in welchem Keiner etwas von dem Anderen hörte. Nachdem der erste Sturm der Freude sich jetzt gelegt hatte, und das Frühstück beseitigt worden war, fragte der Ritter den Schüler, wie es ihm denn gegangen sei?
Darauf, mein Freund, kann ich dir eine sehr kurze und müßte ich dir eine sehr lange Antwort geben, versetzte der Schüler. Eine kurze, wenn ich dir bloß die äußere Figur und Schaale meines zeitherigen Lebens vorzeichnen soll; eine lange, o eine unendlich lange, begehrst du, den inneren Kern aus dieser Schaale zu kosten!
Ei, Närrchen, rief der Ritter, was für schwere Reden führst du da! Gieb mir die Schaale und ein Stückchen vom Kern, wenn die ganze Nuß zu groß für eine Mahlzeit ist.
So wisse, erwiederte der Andere, daß mein sichtbares Leben zwischen engen Ufern rann. Ich wohnte in einem kleinen düsteren Gäßchen bei stillen Leuten, im Hinterhause. Mein Fenster ging auf den Garten hinaus, dessen Bäume und Stauden ihren ernsten Hintergrund von den Mauern des Tempelhauses erhielten. Ich hielt mich sehr einsam und für mich, knüpfte weder mit den Bürgern, noch mit den Schülern Umgang an. So ist es gekommen, daß ich von der großen Stadt nichts kennen gelernt habe, als die Straße von meinem Häuschen nach den Dominicanern, wo mein großer Meister lehrte.
Wenn ich nun in meine Klause zurückgekehrt war und die Mitternacht bei der Studirlampe herangewacht hatte, so blickte ich wohl aus dem Fenster, um die erhitzten Augen an dem dunkeln Sternenhimmel abzukühlen. Dann sah ich nicht selten in dem gegenüberliegenden Tempelhause Licht; bei dem Scheine rother Fackeln zogen die Ritter in ihren weißen Ordensmänteln wie Geister durch die Gallerien, verschwanden hinter den Pfeilern und kamen dann wieder zum Vorschein; im äußersten Eck des Flügels wurden vor den Fenstern Vorhänge niedergelassen, durch deren dünne Stellen aber ein wundersamer Schein drang, und hinter welchen sich Weisen vernehmen ließen, welche süß und schaurig wie verbotenes Gelüste durch die Nacht drangen.
So gingen meine Tage hin, unscheinbar von außen, innen aber ein glänzendes Fest aller Wunder. Albertus zeichnete mich bald vor den übrigen Schülern aus; nicht lange, so merkte ich, daß er gewisse Worte, die den Andern unbeachtet vorüberschlüpften, gegen mich mit einer besonderen Betonung zu wiederholen pflegte; Worte, die auf den geheimnißvollen Zusammenhang alles menschlichen Wissens und auf eine tief unten in dunkler Verschwiegenheit treibende gemeinsame Wurzel des großen Baumes hinwiesen, welcher da droben am Lichte seine gewaltigen Zweige als Grammatik, Dialectik, Redekunst, Zahlenlehre, Geometrie, Astronomie und Musik auseinanderlegte. – Sein Auge ruhte bei solchen Worten durchdringend auf mir, und meine Blicke ließen ihn erkennen, daß er eine tiefe Sehnsucht nach den letzten und größten Schätzen seines Geistes in mir entzündet hatte.
So kam es denn allgemach, daß ich der Vertraute seiner heimlichen Werkstatt und der Lehrling wurde, auf den er einen Theil seines Pfundes als kostbares Vermächtniß vererben wollte. – Es giebt nur ein Mark der Dinge, welches hier im Metall lastet und wieget, dort in der schwankenden Pflanze, im leichtsinnigen Vogel vom Urkern sich abzulösen ringt. Alles wandelt und verwandelt sich; Gott wirkt zwar in der Natur, aber die Natur wirkt auch für sich, und wer der rechten Kräfte Meister ist, der kann ihr eigenes und selbstständiges Leben hervorrufen, daß ihre sonst in Gott gebundenen Glieder sich zu ganz neuen Regungen entfalten. – Mein hoher Meister führte mich an sicherer Hand dem Brunnen zu, wo jenes Mark der Dinge quillt. Ich tauchte meinen Finger hinein, da wurden alle meine Sinne voll übermenschlichen Schauens. In der rußigen Schmelzküche saßen wir seitdem oft zusammen und schauten in die Gluthen des Ofens; er vorn auf niedrigem Schemel, ich hinter ihm kauernd, mich fest an ihn drückend und ihm die Kohlen oder die Erze darreichend, die er mit der Linken in den Tiegel warf, denn mit der Rechten hielt er mich liebreich gefaßt. Da wehrten sich die Metalle, die Salze und die Säuren prasselten, wie in einer festen Burg wollte sich der hohe König, der alle Welt regiert, inmitten scharfwinklichter Krystalle vertheidigen, zornig entbrannten die rothen, blauen und grünen Vasallen und streckten uns die glühenden Speere abwehrend entgegen, aber wir brachen die Werke und kämpften die Mannen danieder, und über Schlackentrümmer hinüber lieferte sich uns demüthig der glänzende Fürst aus. Das Gold an sich ist Nichts für den, der sein Herz nicht an Irdisches hängt, aber diese theuerste und köstlichste Gabe der Natur in Allem und Jedem, auch in dem Geringfügigsten und Unscheinbarsten zu erkennen, das gilt dem Weisen viel. Zu andern Stunden wiesen uns die Sterne ihre Kreise, die als Geschichte sich ablösten und zur Erde sanken, oder die innigen Verwandtschaften der Töne und der Zahlen wurden wach, und zeigten uns die Bündnisse, welche zu schildern kein Wort genügt, die sich vielmehr nur wieder in Zahl und Ton offenbaren. In allem diesem geheimen Wesen und Weben aber schwebte, daß es nicht wieder zu kalter klebriger Gestaltung gerinne, ewig verbindend und ewig lösend, sich in dem Hader nieverwelkender Jugendkraft in sich und an den Dingen entzweiend, das Große, Unergründliche; der dialectische Gedanke.
O selige, genügliche Zeit des erschlossenen Verstehens, des Wandelns durch die inneren Säle des Pallastes, an dessen metallener Pforte die Andern vergeblich anklopfen! Endlich – –
Der fahrende Schüler, dessen Lippen bei der Erzählung sich in einem dunkeln Rothe immer glühender gefärbt hatten, und dessen Augen von einem seltsamen Feuer blitzten, hielt hier, wie aus seiner Begeisterung plötzlich ernüchtert, inne. Der Ritter wartete vergeblich auf die Vollendung der Rede, dann sagte er zu seinem Freunde: Nun? Endlich –
Endlich, versetzte der Schüler mit einem gezwungen-gleichgültigen Tone, mußten wir uns doch trennen, wenn auch nur auf kurze Zeit. Mein hoher Meister schickt mich jetzt nach Regensburg, aus der Sakristei des Domes gewisse Schriften zu erbitten, die er als Bischof dort zurückgelassen hat. Ich bringe sie ihm und werde dann freilich meine Tage, wenn es angeht, bei ihm verleben.
Der junge Ritter tröpfelte den Rest des Weins in den Becher, sah hinein und trank den Wein bedächtiger als er früher gethan hatte. Du hast mir da wunderbare Sachen vertraut, hob er nach einigem Schweigen an, Sachen, in die ich mich nicht wohl zu finden weiß. Gottes Welt scheint mir so schön geputzt zu seyn, daß es mir kein Vergnügen machen würde, diese lieblichen Schleier abzustreifen, und, wie du sagst, in das Innere der Creatur zu schauen. Der Himmel blaut, die Sterne leuchten, der Wald rauscht, die Kräuterlein duften, und ist dieses Blauen, Leuchten, Rauschen und Duften nicht das Allerschönste, hinter welchem es kein Schöneres mehr giebt? Verzeihe mir; aber ich bin nicht neidisch auf deine geheime Wissenschaft. – Du Armer! Roth macht sie nicht, diese Wissenschaft. Deine Wangen sind ganz bleich und eingefallen.
Einem Jeden werden seine Pfade gewiesen, dem Einen dieser, dem Andern jener, versetzte der Schüler. Nicht der Sprung des Blutes macht das Leben aus; weiß ist der Marmor, und Marmorwände pflegen die Räume einzuschließen, in welchen Götterbilder aufgerichtet stehen. – Doch genug davon, und nun zu dir. Was hast du denn getrieben, seit wir uns nicht sahen?
Ach davon, rief der junge Ritter Konrad mit seiner ganzen Lustigkeit, ist wenig zu vermelden! Ich stieg zu Roß und stieg wieder herunter, fuhr an manchen guten Fürstenhöfen umher, verstach manchen Speer, gewann manchen Dank, misste manchen Dank, schaute in manches minniglichen Weibes Auge. Meinen Namen kann ich schreiben, meinen Degenknopf drücke ich daneben in Wachs ab, ein Lied kann ich reimen, wenn auch nicht so gut, wie Meister Gottfried von Straßburg. Schwertleite und Waffenwacht brachte ich hinter mich und empfing den Ritterschlag zu Forchheim, jetzt reite ich gen Maynz, wo der Kaiser das Turnier halten will, mich baß zu tummeln und des Lebens zu freuen.
Der Schüler sah nach dem Stande der Sonne und sagte: Es ist traurig, daß wir nach diesem herzlichen Treffen uns so bald wieder trennen sollen. Aber doch wird es, wenn wir unser Ziel heute zu erreichen wünschen, nothwendig seyn.
Komm mit gen Maynz! rief der Andere, indem er aufsprang und den Schüler in einer sonderbar gerührten Stimmung, die gleichwohl ein Lachen zuließ, ansah. Laß das finstere Regensburg und den Dom und die Sakristei; erheitere dein Antlitz unter fröhlichen Gesellen am runden Tisch in der Weinlaube und vor den Blumenfenstern lieblicher Mädchen, laß deine Ohren durch Flöten- und Schallmeienklang rein baden von den schauerlichen Vigilien der Tempelherren, die ja in der ganzen Christenheit für arge Ketzer und Baffometuspriester gelten. Komm mit gen Maynz, mein Petrus!
Die letzten Worte sprach er schon im Sattel. Er streckte dabei wie flehend seine Hand nach dem Freunde aus. Dieser wandte sich seitwärts ab und zog seinen Arm verweigernd zurück. Was fällt dir ein? rief er unwillig lächelnd. Ach, mein Konrad, hätte ich nicht vorher gesagt, daß Jedem seine Straße gewiesen sei, so würde ich dir zurufen: Kehre du um, du Leichtsinn, du Fahrlässiger! Die Jugend vergeht, der Scherz verklingt, das Lachen will eines Tages plötzlich nicht mehr gelingen, weil das Antlitz zu starr geworden ist, oder grinset widerwärtig aus welken Runzeln! Wehe dem, wessen Scheuren dann nicht voll, wessen Kammern nicht gerüstet sind! Ach! es muß etwas Trübes um so ein kahles, verarmtes Alter seyn, und das Sprichwort hat wohl Recht, welches sagt: Zu lustig am Morgen, schafft Abends Kummer und Sorgen. Wenn ich dich so ansehe, mein Jugendbruder, kann mir recht bange um dich werden, o wer weiß, wie verwandelt ich dich wieder treffe!
Der Ritter schüttelte dem ernsten Schüler herzlich die Hand und rief: Vielleicht bist du verwandelt, stoßen wir wieder auf einander, prunkst in Sammet und Seide, und thust’s uns Allen zuvor! – Er sprengte davon, und aus der Ferne hörte der Schüler ihn noch ein Lied singen, welches damals von Mund zu Munde ging und ungefähr so lautete;
Die schönste Rose, die da blüht,
Das ist der rosenfarbne Mund
Von wonniglichen Weiben;
Sie thut sich erst als Knospe kund,
In sich geschlossen, und bemüht,
So recht für sich zu bleiben!Der Mai küßt alle Rosen wach,
Auf rosenfarbnen Mund der Kuß:
Die Lippe kommt zum Blühen;
Drum keine Lippe ohne Kuß,
Und jedem Kuß an seinem Tag
Der schönsten Lippen Glühen!
Ein Schmetterling flog vor dem Schüler auf. Ist das Leben der meisten Menschen nicht dem Flattern dieses Falters zu vergleichen? sagte er. Bunt und leicht prunkt er dahin und doch sind seine Freuden so kurz und öde. Mit gewaltigen, großen Augen blickt er umher, aber die matten Spiegel empfinden nur eine leere Abwechselung von Licht und Schatten, nicht die volle Gestalt, die feste Farbe. – Der Wald sah ihn aus seinen grünen Tiefen mit unwiderstehlichem Blick an. Was thut’s, rief er, wenn mein geduldig Thier auf diesem Rasen eine Weile allein zurückbleibt! Es läuft mir nicht davon, ich spüre so eine innige Sehnsucht, ein Stündchen da hinein zu wandern, wie labend muß es da tief drinnen seyn!
Er schritt seitab von der Landstraße auf einem engen Pfade, der sich nach kurzem Gehen zwischen den hohen Stämmen zu Thale senkte, in den Wald, und war bald in einer völligen Einsamkeit, in der es um ihn her rauschte, flüsterte, schwirrte, und nur einzelne Sonnenlichter, grünlich gebrochen, wie Irrlichter ihn umspielten. Zuweilen war es ihm, als ob sein Name hinter ihm aus der Ferne gerufen werde, er wußte selbst nicht, der Ruf kam ihm widerwärtig und hassenswürdig vor, dann hielt er den Ton auch wohl wieder für eine Täuschung, aber er mochte dies oder das denken, fürbaß schritt er nur immer tiefer in den dunkeln Forst. Große knorrige Baumwurzeln lagen wie Schlangen quer über den Weg hin gespannt, daß der Schüler beinahe über sie gestolpert wäre, Hirschkäfer standen wie Edelwild im Moose. Aus kleinen Felsgrotten leuchtete der Pfittichglanz des Goldmooses. Der Schweiß stand ihm vor der Stirne, wie er so immer hastiger sich in das Dickicht hineinarbeitete und vor der lichten Sonnenwelt da draußen floh. Aber es war nicht bloß der Gang, der ihm heiß machte, auch sein Gemüth arbeitete unter der Last schwerer Erinnerungen. – Endlich kam er, nachdem ihm der Pfad längst unter den Füßen geschwunden war, auf einen schönen, glatten, dunkeln Platz unter mächtigen Eichen. Noch immer hörte er aus der Ferne seinen Namen rufen. Hier wird mich der rohe Laut von da draußen nicht mehr erreichen, sagte er, hier werde ich still geborgen seyn. Er sank an einem großen moosbedeckten Steine nieder, seine Brust wogte, er kämpfte mit einem gewaltigen Gelüste. Vergieb mir, hoher Meister, meinen Fürwitz, rief er; aber es giebt ein Wissen, dem die That folgen muß, sonst erdrückt es den Sterblichen! Hier, näher dem Herzen der großen Mutter, wo unter dem Sprießen und Wachsen schon vernehmlicher ihre Pulse klopfen, hier muß ich es aussprechen, das Zauberwort, welches ich von deinen schlafenden Lippen ablauschte, als du es im Traume sprachest; das Wort, auf dessen Ertönen die Creatur den Schleier hinwegwirft, die Kräfte sichtbar werden, die unter Rinde und Haut und im Kerne des Felsens arbeiten, und die Sprache des Vogels dem Ohre verständlich klingt.
Seine Lippen zuckten, das Wort zu sprechen, aber noch hielt er inne, denn vor sein Auge trat der kummervolle Blick, mit dem ihn sein großer Meister Albertus gebeten hatte, nach seinem Beispiele von der zufällig erlangten Kunde keinen Gebrauch zu machen, da schwere Dinge dem Menschen bevorständen, der mit Absicht das Zauberwort spräche.
Plötzlich jedoch rief er es, wie von dem Verbote und von der Furcht nur um so gewaltiger vorwärts gestoßen, laut in den Wald, indem er seine Rechte ausreckte.
Alsobald that es in ihm einen Schlag und einen Ruck, daß er meinte, der Blitzstrahl habe ihn getroffen. Seine Augen erblindeten, und es war ihm, als ob ihn ein reißender Wirbelwind im Kreise durch den unermeßlichen Raum schleudere. Als er entsetzt und schwindlicht mit den Händen umhergriff, fühlte er zwar den moosigen Stein, an dem er gestanden, und kam dadurch in seinem Innern wieder zur Erde zurück, aber nun geschah an ihm ein neues unheimliches Zeichen. Denn wie er vorher gleich einem Sandkorn durch das All geschleudert worden war, so kam es ihm nun vor, als ob sich sein Leib in das Unendliche ausdehne. Unter furchtbaren Schmerzen trieb die neue in ihm aufgewachte Kraft seine Gliedmaßen zu ungeheurer Größe, daß er meinte, er müsse an den Himmel rühren. Die Wände seines Hauptes und seiner Brust wurden tempelweit, in sein Ohr fielen Töne, fremd, zerreißend, himmlisch, und er sagte zu sich: Das ist der Gesang der Sterne in ihren goldenen Bahnen. Endlich machten die Schmerzen einer prickelnden Wollust Raum, in welcher er seinen Körper wieder zu gewöhnlichem Maaße zusammenschrumpfen fühlte, während die Riesengestalt wie eine äußere Schaale oder eine Art von Atmosphäre in luftigen Umrissen um ihn stehen blieb. Die Finsternisse wichen von seinen Augen, indem sich große, gelbglänzende Lichtflächen, wie bei dem Gefühle der Blendung, von den Aepfeln ablösten und in die Augenwinkel zogen, wo sie allmählig verschwanden.
Während er so wieder sehend wurde, sang ein feiner, süßstimmiger Chor um ihn her – er wußte nicht, waren es die Vögel allein, oder gaben auch Zweige, Stauden und Gräser ihren Beitrag? – ganz vernehmlich:
Wir dürfen’s ihm sagen,
Er muß es ertragen;
Gehört uns nun eigen,
Wird balde
Im Walde
Erkalten und schweigen.In dem moosigen Felsblock murrte es leise aber hörbar, es war, als ob der Stein sich regen wollte und könnte es nicht, wie ein Scheintodter. Der Schüler blickte auf die Fläche des Steins, ach! da liefen die grünen und rothen Adern zu einem uralten Antlitz zusammen, welches ihn aus müden Augen so wehmüthig und hülfeflehend anschaute, daß er sich erschüttert abwandte und bei den Bäumen, Pflanzen und Vögeln Trost suchte.
Unter denen war auch Alles verwandelt. Wenn er auf das kleine braune Moos trat, so ächzte es und schrie über den unsanften Druck, und er sah, wie es die behaarten Händchen rang und die gelben oder grünen Häuptlein schüttelte. Die Stengel der Pflanzen und die Stämme der Bäume befanden sich in einer immerwährenden schraubenförmigen Bewegung, und zugleich ließ ihn die Rinde oder die äußere Haut in das Innere blicken, worin seine Geisterlein zartglänzende Tröpfchen in die Röhren schütteten. Dann stieg das klare Naß von Röhre zu Röhre, indem sich unaufhörlich Klappen öffneten und zuschlossen, bis es oben in den Haarröhrchen der Blätter zu einem grünen Dufte wurde. Leichte Verpuffungen und Feuer entzündeten sich nun in dem Geäder der Blätter; ein Aetherisches, Flammendes spieen unaufhörlich ihre fein-geschnittenen Lippen aus, während eben so unaufhörlich der schwerere Theil jener feurigen Erscheinungen in weichen Dampfwellen durch die Blätter hin und her schlich. In den blauen Glockenblumen, die auf dem feuchten Waldgrunde standen, war ein Klingen und Singen; sie trösteten mit einem schönen Liede das arme alte Antlitz im Stein und sagten, wenn sie nur vom Boden los könnten, so würden sie ihm herzlich gern die Erlösung bringen. Aus den Lüften blickten den Schüler sonderbare grüne, gelbe und rothe Zeichen an, die immer sich zum Bilde fügen wollten und dann wieder auseinanderbrachen, von allen Seiten kroch und schritt das Gewürm und Gekäfer an ihn heran und trug ihm verworrene Anliegen vor; der Eine wollte dies seyn, der Andere das, der Eine begehrte eine neue Flügeldecke, der Andere hatte sich den Rüssel abgebrochen; was in den Lüften zu schweben pflegte, bettelte um Sonnenschein, das Kriechende dagegen um die Feuchtigkeit. Dieses ganze Gesindel nannte ihn seinen Herrgott, so daß ihm fast wieder die Sinne zu schwanken begannen.
Auch bei den Vögeln war des Zwitscherns, Plapperns und Erzählens kein Ende. Ein Buntspecht kletterte an der Borke einer großen Eiche auf und nieder, hackte und pickte nach den Würmern und ward nicht müd’ zu schreien: Ich bin der Förster; ich muß für den Wald sorgen! – Der Zaunkönig sagte zum Finken: Es ist gar keine Freundschaft mehr unter uns; der Pfau will nicht leiden, daß auch ich ein Rad schlage, er meint, er habe allein das Recht dazu, und hat mich verklagt beim höchsten Gericht, und ich kann doch ein so schönes Rädlein schlagen mit meinem braunen Schwänzlein. – Der Fink versetzte: Laß mich zufrieden. Ich freß’ mein Korn und kümmere mich sonst um Nichts; ich hab’ ganz andere Sorgen, zu meinem Waldschlag lern’ ich die eigentlichen kunstmäßigen Weisen nur hinzu, wenn sie mich blenden; es ist aber schrecklich, daß aus Einem erst was Rechtes wird, wenn man so hart verstümmelt worden ist. – Von Diebstählen plauderten die Andern und von Mordthaten, die Niemand gesehen, als die Vögel:
Sie fliegen wohl über den Kreuzweg hin,
Schaut Keiner nach ihnen hin!
Dann setzten sie sich auf den Zweigen straff zurecht, kuckten den Schüler spöttisch an und zwei freche Kohlmeisen riefen: Da steht der Zauberer und hört uns zu und weiß nicht, was mit ihm geschieht; nun, der wird Augen machen! – Der wird Augen machen! schrie der ganze Haufen und flog mit einem Gezwitscher davon, welches wie ein halbes Lachen klang.
Indem bekam der Schüler einen Wurf in das Gesicht, er blickte empor, da sah er ein ungeschliffenes Eichhorn, das hatte ihm die hohle Nuß auf die Stirne geworfen, lag platt auf seinem Aste auf dem Bauche, stierte ihm in’s Gesicht, und rief: Die hohle für dich, die volle für mich! – Ihr ungezogenes Gesindel, laßt den fremden Herrn doch zufrieden! rief eine schwarz und weiße Elster, die wackelnd durch das Gras herzugeschritten kam. Sie setzte sich dem Schüler auf die Schulter und sagte ihm in’s Ohr: Ihr müßt nicht uns Alle nach jenen unhöflichen Bestien beurtheilen, gelahrter Herr, es giebt auch unter uns wohlgezogene Leute. Da seht einmal durch die Oeffnung hindurch jenen weisen Mann, das Wildschwein, wie es ruhig steht und seine Eicheln verzehrt, und dabei im Stillen seine Gedanken hat. Herzlich gern will ich Euch Gesellschaft leisten und Euch erzählen, was ich nur weiß, das Reden ist mein Vergnügen, besonders mit alten Leuten.
Wenn das ist, so wirst du bei mir deine Rechnung nicht finden, ich bin noch jung, versetzte der Schüler.
Ach Himmel, wie sich die Menschen täuschen können! rief die Elster und sah ganz gedankenvoll vor sich hin.
Indem war es dem Schüler, als höre er aus noch größerer Tiefe des Waldes ein Seufzen, dessen Ton ihm durch das Herz drang. Er fragte seine schwarz und weiß gesprenkelte Gesellschafterin nach der Ursache, die sagte ihm aber, sie wolle zwei Eidexen darum ausforschen, die dort ihr Morgenbrod äßen. Er ging nun mit der Elster auf der Schulter nach dem Orte, wo diese Thierchen sich befinden sollten. Da hatte er eine wunderhübsche Schau. Die beiden Eidexchen waren gewiß vornehme Fräulein, denn sie saßen unter einem großen Pilze, der wie ein prachtvolles Schirmzelt sein goldgelbes Dach über ihnen ausspannte. Dort saßen sie und schlürften mit den braunen Züngelchen den Thau vom Grase, dann wischten sie sich die Mäulchen an einem Hälmlein ab und gingen mit einander im anstoßenden Lusthain von Farrenkräutern spazieren, welcher vermuthlich der Einen zugehörte, die ihre Freundin bei sich zum Besuch hatte. Schack! Schack! rief die Elster; der Herr möchte gern wissen, wer geseufzt hat? Die Eidexchen hoben die Köpfchen empor, wedelten mit den Schwänzchen und riefen:
Prinzessin in der Laub’ am Bronnen,
Der Kanker hat sie eingesponnen.Hm! Hm! sagte die Elster und wackelte mit dem Kopfe, daß man so vergeßlich seyn kann! Ja freilich, in der nahen Hainbuchenlaube schläft die schöne Prinzessin Doralice, die der böse König Kanker eingesponnen hat. O möchtet Ihr sie erretten, gelahrter Herr! – Den Schüler trieb das Herz, er fragte die Elster, wo die Laube sei? Der Vogel flog voran von Zweig zu Zweig, den Weg zu zeigen; so kamen sie an eine stille Wiese, rings eingeschlossen, durch welche ein Bächlein, aus einer Felsenspalte springend, floß, wo gar artige Läublein von Hainbuchen standen. Die Bäumchen hatten ihre Zweige zur Erde geschlagen, so daß sie den Boden wie ein Dach überwölbten, durch diese Dächer aber stachen die Fächerblätter des Farrenkrauts und schufen den Laubhäuslein die Lucken und Giebel. Die Elster sprang auf eins der Laubhäuslein, schaute durch eine Lucke und flüsterte geheimmßvoll: Hier schläft die Prinzessin. – Mit klopfendem Herzen trat der Schüler hinzu, kniete vor der Oeffnung der Laube nieder und blickte hinein – ach! da wurde ihm ein Anblick, der ihm Sinn und Seele in noch gewaltigeren Aufruhr jagte, als da er das Zauberwort aussprach. Auf dem Moose, welches wie ein Pfühl die schöne Last umquoll, ruhte die reizendste Jungfrau und schlummerte. Ihr Haupt lag etwas erhöht, den einen Arm hatte sie unter den Nacken geschoben, die weißen Finger leuchteten aus dem Goldbraun der Locken, welche in langen weichen Fluthen sich zärtlich um Hals und Busen schmiegten. Mit unsäglicher Wonne und Wehmuth schaute der Schüler in das herrliche Antlitz, auf den Purpur der Lippen, auf die Blüthe der Glieder, von denen ein verklärender Wiederschein auf das dunkele Mooslager fiel. Daß die Schläferin, wie von einem geheimen Drucke belastet, in süßer Angst zu athmen schien, machte sie in seinen Augen nur noch verlockender, er fühlte, daß sein Herz auf immerdar gefangen genommen sei, und nur an diesem Munde sein Lechzen stillen könne. Ist es nicht Schade, sagte die Elster, die durch die Lucke in die Laube gehüpft war, und sich der Schläferin auf den Arm setzte, daß eine so schöne Prinzessin sich hat müssen einspinnen lassen? – Wie? Einspinnen? fragte der Schüler; sie ruht ja, in ihren weißen Schleier gehüllt. O Thorheit! rief die Elster, ich sage, es sind Spinnweben und der König Kanker hat sie eingesponnen. – Wer ist der König Kanker?
Im menschlichen Zustande war er ein reicher Garnspinnerherr, versetzte die Elster, indem sie wohlgefällig mit dem Schwanze wippte. Er hatte seine Garnspinnerei nicht weit von hier, außer dem Walde, am Flüßchen, und an die hundert Arbeiter spannen unter ihm. Das Garn wuschen sie im Flüßchen. Darin wohnt aber der Nix, und der war ihnen schon lange bitterböse, weil sie mit der ekelhaften Wäsche seine klaren Fluthen trübten, und weil alle seine Kinder, die Schmerlen und die Forellen, von der Beize abstanden. Er wirrte das Garn untereinander, die Wellen mußten es über den Rand des Ufers schleudern, er trieb es abwärts in die Strudel, um den Spinnerherrn zu warnen, aber Alles war vergeblich. Endlich, am Johannistage, an welchem die Flußgeister Macht haben, zu schrecken und zu schaden, spritzte er der ganzen Garnwäscherzunft und ihrem Haupte, da sie eben wieder ihre Wäscherei recht frech und gewissenlos trieben, Feienwasser in das Antlitz, und, wie wilde und blutdürstige Menschen Währ-Wölfe und Währ-Kater werden können, so sind die Garner und ihr Haupt Währ-Kanker geworden. Sie liefen Alle vom Flüßchen zum Walde und hangen mit ihren Geweben überall an Bäumen und Sträuchen umher. Die Spinner sind gewöhnliche kleine Kanker geworden, fangen Fliegen und Mücken; ihr Herr aber hat fast seine frühere Größe behalten und heißt der Kanker-König. Er stellt den schönen Mädchen nach, umspinnt sie, betäubt sie mit seinem giftigen Dunste und saugt ihnen dann das Blut vom Herzen. Zuletzt hat er diese Prinzessin überwältigt, welche von ihrem Gefolge im Walde abgekommen war. Sieh dort – dort – dort regt er sich zwischen den Büschen.
Wirklich war es dem Schüler, als sehe er durch die Zweige gegenüber einen riesigen Spinnenleib schimmern, zwei haarige Füße, dick wie Menschenarme arbeiteten sich durch das Laub; eine entsetzliche Angst um die schöne Schläferin ergriff ihn, er wollte dem Ungeheuer entgegenstürzen. Umsonst! rief die Elster und schlug mit den Flügeln; alle verzauberte Menschen haben furchtbare Kräfte, das Ungethüm würde dich in der Umknotung ersticken, aber streue deiner Schönen Farrensaamen auf die Brust, der macht sie unsichtbar vor dem Kanker-König, und so lange nur ein Stäubchen davon liegt, dauert der Segen aus. Eiligst streifte der Schüler den braunen Staub von der unteren Fläche eines Farrenblattes ab und that, wie ihm der Vogel gesagt hatte. Indem er sich hiebei über die Schläferin beugte, rührte ihr Othem seine Wange. Verzückt rief er: Giebt es kein Mittel, dieses geliebte Bild zu befreien? Oh! schrie der Vogel und schoß wie toll in Zickzackflügen um den Schüler, wenn Ihr mich um so ein Mittel befragt, das giebt es wohl. Unser weiser Alter in der Kluft hat den Eibenbaum in Verwahr, wenn Ihr davon einen Zweig bekommt und mit demselben die Stirne der Schönen dreimal berührt, so weicht alle Fesselung von ihr,
Denn vor den Eiben
Die Zauber nicht bleiben;sie wird in Eure Arme sinken und Euch, als ihrem Retter, angehören. In diesem Augenblicke war es, als ob die Schlafende die Reden des Vogels vernähme. Ihr schönes Gesicht wurde von einer zarten Röthe überzogen, ihre Züge nahmen den Ausdruck einer unendlichen Sehnsucht an. Führe mich zum weisen Alten! rief der Schüler halb von Sinnen.
Der Vogel sprang in die Büsche, der Schüler eilte ihm nach. Die Elster flatterte einen engen Felsenweg empor, der bald nur noch über Morast und wildumhergeworfene Steinblöcke gefährlich hinanleitete. Von Block zu Block mußte der Schüler klimmen, wollte er nicht im Sumpfe versinken. Seine Kniee zitterten, seine Brust keuchte, seine Schläfe bedeckte kalter Schweiß. Er rupfte in der Eile Blumen und Blätter ab und streute sie auf die Steine, damit er den Weg wiederfinden möchte. Endlich stand er auf bedeutender Höhe vor einem geräumigen Felsenportal, aus dessen dunkelem Schlunde ihm eine Eisluft entgegenstrich. Die Natur schien hier noch in der uralten Gährung zu seyn, so fürchterlich und zerrissen starrte das Gestein über, neben, vor der Höhle.
Hier wohnt unser Weiser! rief die Elster, indem sich ihre Federn vom Kopf bis zum Schweife sträubten und kraus’ten, so daß sie ein unheimliches und widerwärtiges Ansehen bekam. Ich will dich bei ihm anmelden und fragen, wie er über deinen Wunsch gesonnen ist? mit diesen Worten schlüpfte sie in die Kluft. Sie kam aber gleich wieder herausgesprungen und rief: Der Alte ist mürrisch und eigensinnig, er will nicht anders dir den Eibenzweig geben, als wenn du ihm alle Ritzen der Höhle verstopfest, denn er sagt, die Zugluft sei ihm empfindlich. Aber ehe du damit fertig wirst, kann manches Jahr vergehen. – Der Schüler raffte des Mooses und Krautes zusammen, so viel er fassen konnte, und ging nicht ohne Schauder in die Höhle. Drinnen sahen ihn von den Wänden Tropfsteinfratzen an, er wußte nicht, wohin er sein Auge vor den abscheulichen Gestalten retten sollte. Er wollte tiefer in den Felsgang dringen, da schnarchte es ihm aus der hintersten Ecke entgegen: Zurück! Störe mich nicht in meinen Forschungen, treibe da vorne dein Wesen! Er wollte entdecken, wer da spreche, sah aber nichts als ein Paar glührother Augen, die aus dem Dunkel leuchteten. Nun gab er sich an seine Arbeit, stopfte überall Moos und Kraut ein, wo er eine Spalte sah, durch welche ein Schimmer des Tageslichtes drang, aber das war ein schwieriges und, wie es schien, unendliches Werk. Denn, glaubte er mit einer Spalte fertig zu seyn und sich zu einer Anderen wenden zu können, so fiel das Eingestopfte wieder heraus und er mußte von vorn beginnen. Dazu schnarrte das Schnarchende im Hintergrunde der Höhle Töne und Laute ohne Sinn ab und ließ nur bisweilen verständliche Worte ausgehen, die so klangen, als ob es sich seiner tiefen Forschungen berühme.
Die Zeit schien dem Schüler im reißenden Fluge unter seiner verzweiflungsvollen Arbeit vorüber zu eilen. Tage, Wochen, Monate, Jahre kamen, so dünkte ihm, und schwanden, und dennoch spürte er weder Hunger noch Durst. Er glaubte sich dem Wahnwitze nahe und wiederholte sich still mit einer Art von rasender Leidenschaft die Jahreszahl und daß er am Tage Peter und Paul zu Walde gegangen sei, um nicht gar aus aller Zeit zu treten. Wie aus weiter Ferne sah ihn das Bild seiner geliebten Schlummernden an, er weinte vor Sehnsucht und Trauer und doch fühlte er keine Thräne über die Wangen rinnen. Auf einmal war es ihm, als sehe er eine bekannte Gestalt sich der Schläferin nähern, entzückt sie betrachten und sich dann wie zum Kusse über sie beugen. In diesem Augenblicke übermannten ihn Schmerz und Eifersucht, Alles um sich her vergessend stürzte er gegen den dunkeln Hintergrund der Höhle. Den Eibenzweig! rief er heftig. Da wächst er! antwortete das Glühende, Schnarchende, und zugleich fühlte er die Zweige eines Baumes in der Hand, der aus einer finsteren Spalte der Grotte emporstand. Er brach an einem Zweige, da that es ein Winseln um ihn her, das Glühende schnarchte stärker als jemals, die Höhle schwankte, schütterte, stürzte zusammen, Nacht wurde es vor den Augen des Schülers, und unwillkührlich rief es aus ihm hervor:
Vor den Eiben
Kein Zauber thut bleiben.Als seine Augen wieder helle wurden, sah er sich um. Ein dürrer, sonderbar mißfarbiger Stecken lag in seiner Hand. Er stand zwischen Gestein, welches sich zu einer Kluft wölbte, die aber nicht eben mächtig war. In der Tiefe klangen schrillende, pfeifende Töne, wie sie die großen Eulen von sich zu geben pflegen. Die Gegend umher war wie verwandelt. Es war eine mäßige Anhöhe, kahl und ärmlich, mit unbedeutenden Steinen übersäet, zwischen denen auf der einen Seite nach der Tiefe zu durch feuchtes Erdreich der Weg hinableitete, den er heraufgekommen war. Von den großen Felsblöcken war keiner mehr zu erschauen. Ihn fror, obgleich die Sonne hoch am Himmel schien. Es bedünkte ihn, als habe sie denselben Stand, wie damals, als er ausgegangen war, den Zweig zu holen, der nun zum dürren Stecken in seiner Hand geworden war. Er ging den Pfad über die Steine hinab, das Wandern fiel ihm beschwerlich, er mußte sich auf den Stecken stützen, das Haupt hing auf die Brust hinab, er hörte seinen Othem, der mühsam aus ihr hervordrang. An einer schlüpfrichten Stelle des Pfades glitt er aus und mußte sich am Gebüsch halten. Dabei kam ihm seine Hand dicht vor das Auge, die sah grau und runzlicht aus. Herr Gott! rief er, von einem Schauder gepackt, bin ich denn so lange – –? Er wagte seinen eigenen Gedanken nicht auszusprechen. Nein, sagte er, sich gewaltsam beruhigend, es thut die kühle Waldluft, daß mich so friert, matt bin ich von der Anstrengung geworden, und das gebrochene fahlgrüne Licht, welches durch die Büsche fällt, giebt den Händen die seltsame Farbe. Er schritt weiter und sah auf den Steinen die wilden Blumen und Blätter liegen, welche er bei dem Hinaufklimmen dahin gestreut hatte, den Weg zu merken. Sie waren frisch, als seien sie eben hingelegt worden. Damit war ihm ein neues Räthsel gesetzt. Ein Köhler hockte seitwärts vom Wege im Gehölz und schnitt Aeste ab, den fragte er nach dem Tage. Ei Vater, versetzte der Köhler, seid Ihr ein so böser Christ, daß Ihr Apostelntag nicht kennt? Wir haben Peter und Paul, wo der Hirsch aus dem Wald ins Korn tritt. Ich will meinem Jungen da aus dem Maserast ein Spielwerk schneiden, sonst arbeit’ ich nicht an dem Tag, aber das ist zur Lust und Ergötzlichkeit, und die ist erlaubt, sagt der Caplan.
Ich bitte dich, Gesell, rief der Schüler, den das Grauen immer stärker durchrieselte, sag’ mir an, welche Jahrzahl schreibt Ihr in der Christenheit? Der Köhler, von dem auch die Feiertagswäsche den Ruß nicht hatte bringen mögen, hob sich mit seinen mächtigen Gliedern schwarz zwischen den grünen Büschen empor, und sprach nach einigem Besinnen die Jahreszahl aus. – O du mein Heiland! schrie der Schüler und stürzte, von seinem Stecken nicht gehalten, auf den Steinen zusammen. Dann schleuderte er den Stecken hinweg und kroch zitternd den Steinpfad hinab.
Verwundert trat der schwarze Köhler, den Maserast in der Hand, aus den Sträuchen auf die Steine, sah den Stecken liegen, bekreuzte sich und sprach: Der ist von der Eibe, die da droben wächst im Eulenstein, wo der Schuhu horstet. Sie sagen, sie schaffe den Zauber, und löse geschaffenen Zauber. Gott behüte uns! der Alte hatte böse Dinge auslaufen lassen. – Dann ging er in die Büsche zurück, seiner Hütte zu, um das Spielwerk für seinen Knaben zu schnitzen.
Unten auf der lustigen Waldwiese neben der Hainbuchenlaube, am klaren Wässerlein, welches dort seine Ränder zu einem breiten Becken auseinander gespült hatte, saßen der junge Ritter Konrad und die Schöne, welche er ohne magische Künste aus dem Schlummer geweckt hatte. Lieblich drängten sich rothe, blaue und gelbe Kelche aus den Gräsern um sie her, und das Paar blühte in Jugend und Schönheit, der Ritter in seinem bunten Schmuck, die Jungfrau in ihren silberglänzenden Schleiern, als die herrlichste Blume aus diesem Schmelz empor. Er hatte seinen Arm sanft um ihren Leib gelegt und sagte, ihr treu und zärtlich in das Auge sehend: Bei der Asche meiner lieben Mutter, und bei dem heiligen Zeichen auf dem Griffe dieses Schwerts, ich bin, der ich mich dir genannt habe, Herr meiner Schlösser und meiner Tage, und beschwöre dich nun, du holdseliges Wunder dieses Forstes, daß deine Lippen das Wort sprechen, welches mich auf ewig dir in den Besitz geben wird, den der Priester vor dem Altare weihen und segnen soll. –
Was für ein Wort begehrst du noch? sagte die Schöne leise, indem sie züchtig die Wimpern senkte. Hat nicht mein Auge, meine Wange, mein klopfender Busen Alles gesprochen? Minne ist eine gewaltige Königin; sie fährt daher unversehens und ergreift, den sie mag, ohne Widerstand zu dulden. Bringe mich, bevor der Tag sinkt, nach dem Kloster am Odenwald zur frommen Aebtissin, sie wird mich unter Schirm nehmen, dort will ich zwischen stillen Mauern harren, ob du kommen und mich heimführen willst. Sie wollte aufstehen, der junge Ritter hielt sie aber sanft zurück und sagte: Laß uns an diesem Platze, wo meine Seligkeit wie ein goldenes Mährchen emporsproßte, noch einige Augenblicke verweilen. Fürchte ich doch noch immer, daß du mir, gleich einer reizenden Waldnymphe verschwindest! Hilf mir, daß ich an dich glaube und an deine holde Sterblichkeit. Wie bist du hergekommen? Was war mit dir?
Ich war, versetzte die Schöne, heute Morgen zu Walde geflohen vor meinem Vormunde, dem Grafen Archimbald, dessen Absichten plötzlich, ich weiß nicht ob auf mich, oder auf meine Güter, bös und erschreckend hervorgetreten waren. Was hilft der Jugend und dem Weibe reiches Erbe? Es ist immerdar schutzlos und verlassen. Ich wollte mich zur Aebtissin flüchten, ich wollte den Kaiser in Maynz antreten, kaum wußte ich selbst, was ich wollte. So kam ich in diese grünen Baumhallen. Mein Herz war nicht auf den Helfer gerichtet, meine Gedanken haderten mit dem Himmel.
Auf einmal, wie ich diese Wiese schon vor mir liegen sah, war mir, als würde da drüben in den Büschen etwas gesprochen, worauf ich mich und Alles um mich her verwandelt fühlte. Ich kann dir das Wort, oder den Laut nicht beschreiben, mein Geliebter! Der Gesang der Nachtigall klingt heiser gegen seine Süßigkeit und das Rollen des Donners ist, mit ihm verglichen, nur ein schwaches Flüstern. Es war gewiß das Geheimste und Zwingendste, was es zwischen Himmel und Erde geben kann. Auch auf mich übte es eine unwiderstehliche Gewalt, da es in meinen fassungslosen Geist, in das Getümmel meiner Sinne fiel und kein Gedanke des Heils ihm in mir entgegentrat. Meine Augen schlossen sich und doch sah ich den Weg vor meinen Füßen, den die Füße, wie von unsichtbaren, weichen Händen gelenkt, wandeln mußten. Ich schlief und schlief doch nicht, es war ein unbeschreiblicher Zustand, in dem ich endlich unter jener Laube auf weichem Moose niedersank. Es sprach und sang Alles um mich her, in mir fühlte ich den Wogenschlag der jubelndsten Wonne, jeder Tropfen Blutes leuchtete und tanzte durch die Adern und doch saß mir im tiefsten Herzen das alleräußerste Grauen vor dieser Verfassung und die heißeste Bitte um Erweckung aus meinem Schlafe. Aber ich spürte, daß von dem Grauen nichts in mein Antlitz trat, wunderbarer Weise konnte ich mich selbst schauen und sah, daß meine Wangen von der Wonne lächelten, als würden mir himmlische Freudenlieder zugesungen. Immer weiter griff die Wonne in mein Herz, immer weiter drängte sie das Grauen zurück, eine furchtbare Angst befiel mich, daß dieses Pünctchen ganz aus mir getilgt und ich eitel Wonne werden würde.
In dieser Noth, und dem Verschwinden alles Bewußtseyns nahe, gelobte ich mich dem, der mich erwecken und befreien werde, zu eigen. Ich sah nun durch meine geschlossenen Augenlieder eine dunkele Gestalt sich über mich beugen. Das Antlitz war edel und groß, und doch fühlte ich einen tiefen Widerwillen gegen Diesen und es flog wie ein Schatten durch meine Empfindung, daß er es gewesen seyn möchte, der das verdammliche Wort gesprochen habe. Aber immer rief ich stumm in mir und doch laut für mich: Wenn er dich weckt und befreit, so mußt du ihm für diese überschwängliche Wohlthat angehören, denn du hast es gelobt. – Er hat mich nicht geweckt!
Ich, ich habe dich geweckt, mein theures Lieb, und nicht mit Zauberspruch und Segen, nein, mit heißem Kuß auf deine rothen Lippen! rief der junge Ritter entzückt und hielt die schöne Emma fest umschlungen. – Das sind wohl rechte Wunder im Spessart gewesen, die uns zusammengeführt haben. Ich hatte mich draußen am Heerweg von meinem geliebten Freunde Petrus getrennt nach seltsamen verfänglichen Gesprächen. Als ich einige hundert Schritte geritten war, überfiel mich noch einmal eine große Sorge um ihn, ich saß ab und wollte wiederholt ihm ans Herz legen, seine dunkelen Wege zu lassen und mit mir gen Maynz zu ziehen. Als ich mich wandte, sah ich ihn in den Wald schlüpfen. Ich rief seinen Namen, er aber hörte mich nicht. Die Sporen verhinderten mich am raschen Gehen; ich konnte ihm nur von Weitem folgen, doch ließ ich nicht ab, hinter ihm her zu rufen, was aber vergeblich blieb. Endlich verschwand mir sein schwarzer Mantel zwischen den Bäumen. Auch ich sah die schöne grüne Wiese schimmern und wollte mir den lichten Blumenschein besehen. So kam ich her, nachdem ich noch die Kreuz und Quer nach meinem Freunde gesucht hatte. Auch mich umgab es hier im Walde aus den Lüften wie ein Wühlen und Schwingen, das Gewürm war in einer Bewegung, die Vögel verführten ein so eigenes Flattern und Zirpen. – Weil ich aber an die helle gute Straße dachte, auf die ich den Petrus gern bringen wollte, so hat mir vermuthlich das Wesen nichts anhaben können. Als ich dich schlummernd fand, drang mir mit der Gewalt der süßesten Liebe ein ungeheures Mitleid um dich in das Herz, ich frohlockte und weinte doch Thränen, die heißesten, die je aus meinen munteren Augen gekommen. Ich glaube, daß mir vergönnt war, in den Winkel zu schauen, wo dir das Grauen wohnte. Schluchzend und lachend rief ich:
Die schönste Rose, die da blüht,
Das ist der rosenfarbne Mund
Von wonniglichen Weiben;
Am Kuß des Mai’n die Ros’ erglüht,
Es soll der schönste Rosenmund
Nicht ungeküsset bleiben!und da boten meine Lippen in Gottes Namen den Deinen ihren Gruß…
Und die Fesseln fielen ab von mir, ich erwachte, und mein erster Blick traf in dein treues weinendes Auge, rief die schöne Emma. Ich dankte Gott, auf dessen Namen ich mich jetzt wieder besann, daß ich erlöset sei, und dann dankte ich ihm, daß du es gewesen, der mich befreiet habe, und nicht jener Dunkle.
Der junge Ritter war nachdenklich geworden. Ich fürchte, sagte er, alle diese geheimnißvollen Waldwunder stehen mit Petrus in Zusammenhang. Ich fürchte, daß ich an dem Tage, wo ich meine Liebe gewann, meinen Freund verloren habe. Wo mag er nur geblieben seyn?
Das Paar fuhr erschreckt auseinander, denn sie sahen in dem Wasser zu ihren Füßen zwischen ihren blühenden Häuptern ein eisgraues, greises abgespiegelt. Hier ist er, sagte ein zitternder, gebeugter, schneeweißer Alter, der hinter ihnen stand. Er trug den neuen, schwarzen Mantel des Schülers.
Ja, sagte der Alte mit schwacher, erloschener Stimme; ich bin dein Freund Petrus von Stetten. Ich stand schon lange hinter Euch und hörte Eure Reden, und die Geschicke sind klar geworden. Es ist noch der Peter- und Paulstag, an dem wir uns trafen und trennten draußen auf dem Heerwege, der kaum tausend Schritte weit von hier läuft und seit wir von einander gegangen sind, mag eine Stunde verstrichen seyn, denn der Schatten, den der Strauch da auf den Rasen wirft, ist nur um ein Geringes gewachsen. Wir waren vier und zwanzig Jahre alt vor dieser Stunde, du bist darin um sechszig Minuten, ich aber bin derweile um sechszig Jahre älter geworden. Ich habe vierundachtzig. – So sehen wir uns wieder; ich habe es freilich nicht gedacht.
Konrad und Emma waren aufgestanden. Sie schmiegte sich scheu an den Geliebten und sagte leise: Es ist ein armer Irrsinniger. – Nein, du schöne Emma, sagte der Alte, ich bin nicht irre. Dich habe ich geliebt, mein Zauber fiel auf dich, und ich hätte dich haben können, wäre es mir vergönnt gewesen, in Gottes Namen dir den rothen Mund zu küssen, was der einzige Segen ist, womit schöne Minne erweckt wird. Statt dessen mußte ich nach dem Eibenzweige gehen und dem Schuhu seine Klause vor Wind und Wetter verwahren helfen. Nun, wie es gekommen ist, so mußte es kommen. Er hat die Braut, und ich habe den Tod davon getragen.
Konrad hatte immerfort starr in das Gesicht des Alten gesehen, um durch die Runzeln und Falten hindurch ein früheres Lineament des Jugendfreundes zu entdecken. Endlich stammelte er: Ich beschwöre dich, Mensch, uns zu verkünden, wie diese Verwandlung hat zugehen können, damit uns nicht ein Schwindel faßt und zu schrecklichen Dingen treibt!
Wer Gott versucht und die Natur, über den stürzen Gesichte, an denen er rasch verwittert, antwortete der Alte. Dabei bleibt der Mensch, wenn er auch die Pflanzen wachsen sieht und die Reden der Vögel verstehen lernt, so einfältig wie zuvor, läßt sich von einer albernen Elster Fabeln von der Prinzessin und vom Kankerkönige aufbinden, und sieht Frauenschleier für Spinnweben an. Die Natur ist Hülle, kein Zauberwort streift sie von ihr ab, dich macht es nur zur grauen Fabel.
Er schlich langsam in die Waldgründe. Konrad wagte nicht, ihm zu folgen. Er leitete seine Emma aus dem Schatten der Bäume nach der heiteren Straße, wo das Licht in allen Farben um die Kronen der Stämme spielte.
Noch einige Zeit lang hörten die Wanderer im Spessart hinter Felsen und dichten Baumgruppen zuweilen mit einer hohlen und geisterhaften Stimme Reime sprechen, die dem Einen wie Unsinn, dem Anderen wie tiefe Weisheit klangen. Gingen sie dem Schalle nach, so fanden sie den Alten, der noch so wenige Jahre zählte, wie er, erloschenen Auges, die Hände auf die Kniee gestützt, starr in die Weite blickte und die Sprüche vor sich hinsagte, deren Keiner aufbehalten geblieben ist. Nicht lange aber, so wurden sie nicht mehr gehört, und auch den Leichnam des Alten fand man nicht.
Konrad freite seine Emma; sie gebar ihm schöne Kinder und er lebte bis zu späten Jahren mit ihr in großer Freude und Lust.

Bilder: Margaret Vanscheid: Pinnwand Frühjahr & Sommer im Spessart,
nicht genauer nachweisbar, aber ich nehme an, dass viel aus dem Eichhall dabei ist;
erstes und letztes: Rainer Lippert: Naturdenknal seit 1986 Birnbaum am Madenhausener Weg bei Hesselbach, Gemeinde Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt, Wildbirne (Pyrus pyraster), 100 bis 150 Jahre alt, Durchmesser der Krone: 13 Meter, Standort 50° 6′ 46.4“ N, 10° 19′ 0.07“ E, 50.112889°, 10.316686°, 24. Mai 2009:
Der Birnbaum steht außerhalb der Ortschaft am Rande eines Feldes. Der Stamm ist sehr kurz und befindet sich in gutem Zustand. In etwa einem Meter Höhe löst er sich in die Krone auf. Auf gleicher Höhe hat der Stamm auf einer Seite eine sehr große, runde Ausbuchtung, ein ungewöhnlicher Anblick. Die Krone ist sehr hochreichend und in gutem Zustand.
und Naturdenkmal Birne bei Eichenfürst, Gemeinde Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, möglicherweise eine Kultur-Birne (Pyrus communis), 150 bis 200 Jahre alt, Durchmesser der Krone: 17 Meter, Standort 49° 50′ 21.6“ N, 9° 34′ 11.3“ E, 49.839333°, 9.569817°, 27. Februar 2011, aus der Liste regional bedeutsamer Bäume in Unterfranken:
Der Birnbaum steht landschaftsprägend völlig frei auf einem Golfplatz. Von dem Baum aus sieht man weit ins Land hinein. Der Stammbereich ist von Rindenmulch umgeben. Die Birne befindet sich in einem guten Zustand und weist keinerlei Beeinträchtigungen auf. Der hochreichende Stamm hat mehrere knollenartige Ausbuchtungen. Die hoch angesetzte Krone löst sich in etwa fünf Meter Höhe in mehrere lange Äste auf, von denen einer fehlt.
Angemessene zwei Stunden Belohnungsmusik: Cat Power: Speaking for Trees: A Film by Mark Borthwick, 2004 — eine Echtzeit-Live-One-Woman-Show im Walde hinter West Kill Mountain, in der die auf allen Ebenen hinreißende Chan Marshall so lange barfüßigerweise alles herunterspielt, bis es wirklich reicht, die CD und die DVD voll sind und das Video zwiegeteilt werden muss, denn die Sonne wandert schnell:
Diese DVD ist ein Geschenk Gottes. Weil man Cat Power immer möglichst lange bei und um sich wissen will, als Bonus Track auch noch Willie Deadwilder aus: The Greatest, 2005. Fürs Bonusmaterial der Speaking for Trees spielte sie eine 18-Minuten Version:
Nachtstück 0008: Am oberen Zinnrande eines Bierkrugs
Update zu den Nachtstücken 0002 und 0004:

——— Karl Leberecht Immermann:
aus: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken, 1839,
Erstes Buch: Münchhausens Debüt. Vierzehntes Kapitel:
Die Nacht hatte inzwischen den ersten Strahlen des Frühlichts Raum gegeben, welche den Ofen und die Bänke der Wachtstube mit gelbrötlichen Streifen säumten. Unvergleichlich war die Wirkung eines scharfen Schlaglichtes am oberen Zinnrande eines Bierkrugs, von welchem ein seltsamer, aber verstandner Reflex den Knopf des Feldwebelstocks traf, welcher darüber am dritten Haken hing. Überall tiefe, satte Farbentöne, klare, durchsichtige Schatten! Die Wachtstube schien keine wirkliche Wachtstube zu sein, sie war heute mehr, sie war eine gemalte.

Bilder: David Teniers der Jüngere: Eine Wachtstube, ca. 1642, Walters Art Museum, Baltimore, Maryland;
derselbe: Wachtstube mit der Befreiung Petri, ca. 1645–1647, Metropolitan Museum of Art, New York.
Die 104 Minuten Nachtwache Nachtwache (nur echt ohne „Die“), Neue Deutsche Filmgesellschaft-Filmaufbau GmbH, Göttingen 1949, sind leider flächendeckend getilgt, Because the Night, aus: Patti Smith: Easter, 1978, am kurzweiligsten live:
1. Katzvent: Im Bewusstsein seines Wertes sitzt der Kater auf dem Dach
Update zum 2. Katzvent: Confundatus cattus. Schande über den Kater:
Der Advent 2016 führt uns nicht mehr einfach das künstlerische Schaffen über Katzen vor,
sondern das von Katzen.
Als reales Vorbild für den Kater Hiddigeigei gilt der schwarze Kater, möglicherweise gleichen Namens, des Bruchsaler Hofgerichtsrats Albert Preuschen, der unter dem Pseudonym Gerhard Helfrich Gedichte in Zeitschriften und Anthologien zum Drucke gab. — Der Hofgerichtsrat, nicht der Kater.
Hiddigeigei ist keineswegs der erste bekannt gewordene Kater, der mit eigenen Werken hervortrat, wahrscheinlich aber der erste, der aus Ungarn stammt, in Paris kein Auskommen fand, sondern erst in Säckingen, obwohl es seinerzeit noch nicht einmal Kurort war. Beschrieben wird er als grünäugig, mit schwarzem Samtfell, mächtigem Schweif und einem „zuweilen hochmütigen Dulderantlitz“ — kurz: ganz ähnlich wie unser Kater Merlin, der literarisch noch nicht weiter belegt ist. Bad Säckingen erinnert sich an Hiddigeigei:
Sein Glaube an das Gute ist zerbrochen; aus enttäuschter Liebe „lernt er die Welt verachten“. Der arme Kater fürchtet sich vor dem Alter und beschreibt den Niedergang der Menschen und der Dichtung.
Lesen, schreiben und singen konnte nach dem hofgerichtsrätlichen Kater erst diese literarische Ausgestaltung aus Victor von Scheffels (das ist der Schwabe, der die Hymne der Franken geschrieben hat) Best- und Longseller Der Trompeter von Säckingen, 1854. Das ist eine Art Romeo-und-Julia-Geschichte mit Erwachsenen, und eigentlich inzwischen, wie im Untertitel ausgewiesen, nicht mehr ein Sang vom Oberrhein, weil Bad Säckingen, das überhaupt erst seit 1978 „Bad“ heißt, im weiteren Verlauf des 19. Jahrhundetrs geologisch dem Hochrhein zugerechnet wurde — was sich allerdings literarisch nicht merklich auswirkt.
Das Bildmaterial bringt einige auffallende Highlights aus der Darstellungsgeschichte schwarzer Kater, weil unter „Kater Hiddigeigei“ meist nur die gleichnamige, mittlerweile erloschene Gaststätte auf Capri, wo Scheffel den Trompeter schrieb, oder die noch florierende in Bad Säckingen, wo er offiziell fortlebt und weiterhin Trompete bläst, verstanden wird.

——— Victor von Scheffel:
Die Lieder des Katers Hiddigeigei
aus: Der Trompeter von Säckingen. Ein Sang vom Oberrhein;
Vierzehntes Stück. Das Büchlein der Lieder. II.,
Verlag der J. B. Metzlerschen Buchhandlung, Stuttgart 1854:
I.
 Eigner Sang erfreut den Biedern,
Eigner Sang erfreut den Biedern,
Denn die Kunst ging längst ins Breite,
Seinen Hausbedarf an Liedern
Schafft ein jeder selbst sich heute.
Drum der Dichtung leichte Schwingen
Strebt‘ auch ich mir anzueignen;
Wer wagt’s, den Beruf zum Singen
Einem Kater abzuleugnen?
Und es kommt nicht minder teuer,
Als zur Buchhandlung zu laufen
Und der andern matt‘ Geleierv
Fein in Goldschnitt einzukaufen.
II.
Wenn im Tal und auf den Bergen
Mitternächtig heult der Sturm,
Klettert über First und Schornstein
Hiddigeigei auf zum Turm.
Einem Geist gleich steht er oben,
Schöner, als er jemals war.
Feuer sprühen seine Augen,
Feuer sein gesträubtes Haar.
Und er singt in wilden Weisen,
Singt ein altes Katerschlachtlied,
Das wie fern Gewitterrollen
Durch die sturmdurchbrauste Nacht zieht.
Nimmer hören ihn die Menschen,
Jeder schläft in seinem Haus,
Aber tief im Kellerloche
Hört erblassend ihn die Maus.
Und sie kennt des Alten Stimme,
Und sie zittert, und sie weiß:
Fürchterlich in seinem Grimme
Ist der Katerheldengreis.
III.
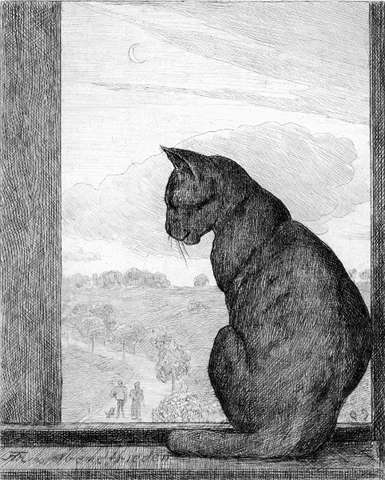 Von des Turmes höchster Spitze
Von des Turmes höchster Spitze
Schau‘ ich in die Welt herein,
Schaue auf erhab’nem Sitze
In das Treiben der Partein.
Und die Katzenaugen sehen,
Und die Katzenseele lacht,
Wie das Völklein der Pygmäen
Unten dumme Sachen macht.
Doch was nützt’s? ich kann den Haufen
Nicht auf meinen Standpunkt ziehn,
Und so laß ich ihn denn laufen,
’s ist wahrhaft nicht schad‘ um ihn.
Menschentun ist ein Verkehrtes,
Menschentun ist Ach und Krach;
Im Bewußtsein seines Wertes
Sitzt der Kater auf dem Dach! —
IV.
O die Menschen tun uns unrecht,
Und den Dank such‘ ich vergebens,
Sie verkennen ganz die feinern
Saiten unsers Katzenlebens.
Und wenn einer schwer und schwankend
Niederfällt in seiner Kammer,
Und ihn morgens Kopfweh quälet,
Nennt er’s einen Katzenjammer.
Katzenjammer, o Injurie!
Wir miauen zart im stillen,
Nur die Menschen hör‘ ich oftmals
Graunhaft durch die Straßen brüllen.
Ja, sie tun uns bitter unrecht,
Und was weiß ihr rohes Herze
Von dem wahren, tiefen, schweren,
Ungeheuren Katzenschmerze?
V.
 Auch Hiddigeigei hat einstmals geschwärmt
Auch Hiddigeigei hat einstmals geschwärmt
Für das Wahre und Gute und Schöne.
Auch Hiddigeigei hat einst sich gehärmt
Und geweint manch sehnsüchtige Träne.
Auch Hiddigeigei ist einstmals erglüht
Für die schönste der Katzenfrauen,
Es klang wie des Troubadours Minnelied
Begeistert sein nächtlich Miauen.
Auch Hiddigeigei hat mutige Streich‘
Vollführt einst, wie Roland im Rasen,
Es schlugen die Menschen das Fell ihm weich,
Sie träuften ihm Pech auf die Nasen.
Auch Hiddigeigei hat spät erst erkannt,
Daß die Liebste ihn schändlich betrogen,
Daß mit einem ganz erbärmlichen Fant
Sie verbotenen Umgang gepflogen.
Da ward Hiddigeigei entsetzlich belehrt,
Da ließ er das Schwärmen und Schmachten,
Da ward er trotzig in sich gekehrt,
Da lernt‘ er die Welt verachten.
VI.
Schöner Monat Mai, wie gräßlich
Sind dem Kater deine Stunden,
Des Gesanges Höllenqualen
Hab‘ ich nie so tief empfunden.
Aus den Zweigen, aus den Büschen
Tönt der Vögel Tirilieren,
Weit und breit hör‘ ich die Menschheit
Wie im Taglohn musizieren.
In der Küche singt die Köchin,
Ist auch sie von Lieb‘ betöret?
Und sie singet aus der Fistel,
Daß sie Seele sich empöret.
Weiter aufwärts will ich flüchten,
Auf zum luftigen Balkone,
Wehe! – aus dem Garten schallt der
Blonden Nachbarin Kanzone.
Unterm Dache selber find‘ ich
Die gestörte Ruh‘ nicht wieder,
Nebenan wohnt ein Poet, er
Trillert seine eignen Lieder.
Und verzweifelt will ich jetzo
In des Kellers Tiefen steigen,
Ach! – da tanzt man in der Hausflur,
Tanzt zu Dudelsack und Geigen.
Harmlos Volk! In Selbstbetäubung
Werdet ihr noch lyrisch tollen,
Wenn vernichtend schon des Ostens
Tragisch dumpfe Donner rollen!
VII.
 Mai ist’s jetzo. Für den Denker,
Mai ist’s jetzo. Für den Denker,
Der die Gründe der Erscheinung
Kennt, ist dieses nicht befremdlich.
In dem Mittelpunkt der Dinge
Stehn zwei alte weiße Katzen,
Diese drehn der Erde Achse,
Dieser Drehung Folge ist dann
Das System der Jahreszeiten.
Doch warum im Monat Maie
Ist das Aug‘ mir so beweglich,
Ist das Herz mir so erreglich?
Und warum wie festgenagelt
Muß im Tag ich sechzehn Stunden
Zum Balkon hinüberschielen,
Nach der blonden Mullimulli,
Nach der schwarzen Stibizzina?
VIII.
In den Stürmen der Versuchung
Hab‘ ich lang schon Ruh‘ gefunden,
Doch dem Tugenhaftsten selber
Kommen unbewachte Stunden!
Heißer als in heißer Jugend
Überschleicht der alte Traum mich,
Und beflügelt schwingt des Katers
Sehnen über Zeit und Raum sich.
O Neapel, Land der Wonne,
Unversiegter Nektarbecher!
Nach Sorrent möcht‘ ich mich schwingen,
Nach Sorrent, aufs Dach der Dächer.
Der Vesuvius grüßt, es grüßt vom
Dunkeln Meer das weiße Segel,
Im Olivenwald ertönt ein
Süß Konzert der Frühlingsvögel.
Zu der Loggia schleicht Carmela,
Sie, die schönste aller Katzen,
Und sie streichelt mir den Schnauzbart,
Und sie drückt mir leis die Tatzen,
Und sie schaut mich an süß schmachtend —
Aber horch, es tönt ein Knurren.
Ist’s vom Golf der Wellen Rauschen?
Ist es des Vesuvius Murren?
’s ist nicht des Vesuvius Murren,
Der hält jetzo Feierstunde,
— In dem Hof, Verderben sinnend,
Bellt der schlechtste aller Hunde.
Bellt der schechtste aller Hunde,
Bellt Krakehlo, der Verräter,
Und mein Katertraum zerrinnet
Luftig in den blauen Äther.
IX.
 Hiddigeigei hält durch strengen
Hiddigeigei hält durch strengen
Wandel rein sich das Gewissen,
Doch er drückt ein Auge zu, wenn
Sich die Nebenkatzen küssen.
Hiddigeigei lebt mit Eifer
Dem Beruf der Mäusetötung,
Doch er zürnt nicht, wenn ein andrer
Sich vergnügt an Sang und Flötung.
Hiddigeigei spricht, der Alte:
Pflück‘ die Früchte, eh‘ sie platzen;
Wenn die magern Jahre kommen,
Saug an der Erinn’rung Tatzen!
X.
Auch ein ernstes gottesfürchtig
Leben nicht vor Alter schützet,
Mit Entrüstung seh‘ ich, wie schon
Graues Haar im Pelz mir sitzet.
Ja die Zeit tilgt unbarmherzig,
Was der einzle keck geschaffen —
Gegen diesen scharfgezahnten
Feind gebricht es uns an Waffen.
Und wir fallen ihm zum Opfer,
Unbewundert und vergessen;
— O ich möchte wütend an der
Turmuhr beide Zeiger fressen!
XI.
 Vorbei ist die Zeit, wo der Mensch noch nicht
Vorbei ist die Zeit, wo der Mensch noch nicht
Den Erdball unsicher machte,
Wo der Urwald unter dem Vollgewicht
Des Mammutfußtritts erkrachte.
Vergeblich spähst du in unserm Revier
Nach dem Löwen, dem Wüstensohne;
Es ist zu bedenken: wir leben allhier
In sehr gemäßigter Zone.
In Leben und Dichtung gehört das Feld
Nicht dem Großen und Ungemeinen;
Und immer schwächlicher wird die Welt,
Noch kommen die Kleinsten der Kleinen.
Sind wir Katzen verstummt, so singt die Maus,
Dann schnürt auch die ihren Bündel;
Zuletzt jubiliert noch in Saus und Braus
Das Infusorien-Gesindel.
XII.
An dem Ende seiner Tage
Steht der Kater Hiddigeigei,
Und er denkt mit leiser Klage,
Wie sein Dasein bald vorbei sei.
Möchte gerne aus dem Schatze
Reicher Weisheit Lehren geben,
Dran in Zukunft manche Katze
Haltpunkt fänd‘ im schwanken Leben.
Ach, der Lebenspfad ist holpernd,
— Liegen dort so manche Steine,
Dran wir Alte, schmählich stolpernd,
Oftmals uns verrenkt die Beine.
Ach, das Leben birgt viel Hader
Und schlägt viel unnütze Wunden,
Mancher tapfre schwarze Kater
Hat umsonst den Tod gefunden.
Doch wozu der alte Kummer,
Und ich hör‘ die Jungen lachen,
Und sie treiben’s noch viel dummer,
Schaden erst wird klug sie machen.
Fruchtlos stets ist die Geschichte;
Mögen sehn sie, wie sie’s treiben!
— Hiddigeigeis Lehrgedichte
Werden ungesungen bleiben.
XIII.
 Arm wird matter, Stirn wird bleicher,
Arm wird matter, Stirn wird bleicher,
Balde reißt des Lebens Faden,
Grabt ein Grab mir auf dem Speicher,
Auf der Walstatt meiner Taten!
Fester Kämpe, trug die ganze
Wucht ich hitzigen Gefechtes:
Senkt mich ein mit Schild und Lanze
Als den Letzten des Geschlechtes.
Als den letzten, — o die Enkel,
Nimmer gleichen sie den Vätern,
Kennen nicht des Geists Geplänkel,
Ehrbar sind sie, steif und ledern.
Ledern sind sie und langweilig,
Kurz und dünn ist ihr Gedächtnis;
Nur sehr wen’ge halten heilig
Ihrer Ahnherrn fromm Vermächtnis.
Aber einst, in fernen Tagen,
Wenn ich längst hinabgesargt bin,
Zieht ein nächtlich Katerklagen
Zürnend über euren Markt hin.
Zürnend klingt euch in die Ohren
Hiddigeigeis Geisterwarnung:
„Rettet euch, unsel’ge Toren,
Vor der Nüchternheit Umgarnung!“

Katzenbilder:
- Vornehmer Tafellikör Hiddigeigei: Magazin Jugend, 1921 via Heidelberger historische Bestände digital;
- Arthur Rackham: Jorinda and Joringel from Grimm’s Fairy Tales, 1909 via The Cinder Fields;
- Hans Thoma: Die Katze via The Macabre & The Bold;
- Irina Savateeva: Hi, September 2016 via Haunted by Storytelling;
- Godmachine: Dark Water via Noichitat;
- Michael Creese: Night Prowler, nach 2009;
- Felix Vallotton: Femme accroupie offrant du lait a un chat, 1919;
- Reading Naked, 30. Oktober 2016;
- Giorgio Sommer, Napoli: Zum Kater Hiddigeigei, Capri 1886 via Galerie Bassenge.
Soundtrack: Die sangesbegabten Katerbuben Al & The Black Cats:
The Light Hit Her Eyes, aus: Givin‘ Um Something to Rock’n’Roll About, 2008:
Der Arzt von Münster in Salzkotten
Update zu Ein holprichtes Lied mit tiefer und rauher Stimme:
Tja, Münsterland ist stockkatholisch, historisch bedingt, (und Immermanns Oberhof für den Kenner sozialer Verhältnisse ein schlechter Witz. Anderes Thema.)
Arno Schmidt: Seelandschaft mit Pocahontas, 1953, Kapitel iv.
Das muss wirklich einer der am sträflichsten unterschätzten Romane der Romantik und des Biedermeiers zusammengerechnet sein: In Die Epigonen. Familienmemoiren in neun Büchern 1823–1835 von 1836 nimmt sich Karl Immerman alle Zeit, die er braucht, weil er etwas zu sagen hat; es war eine Zeit, in der man sich nicht mit einem Exposé bei allen in Frage kommenden Verlagen und noch einigen mehr verzweifelt um Veröffentlichung bewarb, sondern sein Ding „zum Druck beförderte“. Bis heute ist genau 1 ernstzunehmende Ausgabe davon in Umlauf: die von Peter Hasubek, und die ist von 1981, dafür bei Winkler.
Letzteres bedeutet blitzsaubere Verlagsarbeit, in diesem Fall leider auch eine bilderlose Textwüste. Bei meinem letzten Abruf auf Amazon.de gab’s die für 13,64 Euro für einen „guten“ Zustand bei „leichten Gebrauchsspuren“, als Geldausgabe ist das lächerlich. Alle 640 Seiten des Primärtextes — der Rest der 823 Seiten ist Kommentar — funkeln bunt und quicklebendig, ungefähr wie ein Bollywood-Film, der in der deutschen Provinz des Biedermeiers spielt, falls man sich das ungelesen vorstellen kann.
An manchen Stellen brechen die Figuren sogar in dramaturgisch nicht näher gerechtfertigten Gesang aus. Nein, es sind keine Gedichte eingeflochten, wie das kurz zuvor Eichendorff zum Wohle des Gesamtkunstwerks versucht hat; vielmehr hat Immermann, wie erwähnt, etwas zu sagen, und überlässt das seinen Figuren, die deshalb schon mal ein Kapitel ohne Unterbrechung übernehmen. Das bunteste und quicklebendigste Beispiel dafür bringe ich unten ungekürzt. Ich mag das sowieso immer, wenn ein Film, ein Lied oder eben: ein Roman ausreden darf. — In diesem Sinne zur Literaturgeschichte:
 Peter Hasubek verortet im Kommentar das erste Buch Klugheit und Irrtum mit Benno von Wiese: Karl Immermann. Sein Werk und sein Leben, Gehlen Verlag, Bad Homburg, Berlin, Zürich 1969:
Peter Hasubek verortet im Kommentar das erste Buch Klugheit und Irrtum mit Benno von Wiese: Karl Immermann. Sein Werk und sein Leben, Gehlen Verlag, Bad Homburg, Berlin, Zürich 1969:
B. v. Wiese (II, S. 660 f.) weist mit einiger Wahrscheinlichkeit nach, daß es sich dabei um die Brünnekenkapelle in der Nähe von Verne in Westfalen handelt. Für diese Annahme sprechen sowohl einzelne erwähnte Merkmale der Kapelle als auch die umgebende Landschaft. Drei Kilometer entfernt davon liegt der Ort Salzkotten an dem „Großen Heerweg“ […]. Sonach wäre Salzkotten der Handlungsort des ersten Buches der „Epigonen“.
Dieses Buch von Benno von Wiese existiert und ist für schmales Geld antiquarisch erhältlich. Gegen Hasubeks Nachweis spricht jetzt noch, dass es gar keine 660 und mehr, sondern nur 357 Seiten hat; für Berichtigungen von außen aller Angaben und Annahmen, besonders meiner eigenen, bin ich deshalb wie immer dankbar. — Alle handelnden Personen in Haupt-, Rahmen- und Binnenhandlung einschließlich des erzählenden Arztes wären somit als Ostwestfalen, gemäß der Aufteilung durch den Wiener Kongress als Musspreußen zu denken, die anfangs erwähnte Hauptstadt wäre Münster.
Das Bildmaterial stammt deshalb von Rainer V., der die netzweit schönste und dokumentarisch aufschlussreichste Sammlung über den zutiefst teutschen Regierungsbezirk Detmold, in dem Salzkotten heute liegt, beherbergt und vermutlich noch weiter aufstocken wird. Man ist dort überwiegend katholisch, daher scheint diese Gegend über einen besonderen Reichtum an Wegkreuzen aller Bauarten und Widmungszwecke zu verfügen.
——— Karl Immermann:
Zweites Kapitel
aus: Die Epigonen, Zweites Buch. Das Schloß des Standesherrn, 1836:
Der Arzt zog am runden Tische sein Büchelchen hervor, und las:
Der Lieutenant und das Fräulein
Anekdote aus meiner Praxis
Als ich in der Hauptstadt meinen Kursus machte, lernte ich einen Offizier von der Garnison kennen, der mir wegen seines gesetzten Wesens sehr zusagte, und von allen seinen Kamaraden als ein ruhiger Charakter bezeichnet wurde.
Dieser ruhige Charakter war schon seit einigen Jahren mit einem Frauenzimmer von desto unruhigerer Gemütsart verlobt. Fräulein Ida hatte alles Feuer zugeteilt bekommen, welches die Natur bei der Erschaffung des Lieutenants Fabian erspart hatte. Lebendig, galt sie bei ihren Tänzern für geistreich, und konnte allerliebst sein, wenn ihre Partien auf vierzehn Tage hinaus versichert waren. Anfangs spielte sich das Verhältnis überaus artig fort, er wurde von ihrer Beweglichkeit in Bewegung gesetzt, sie gewann durch seinen Ernst mehr Haltung, woran es ihr früherhin zu ihrem Nachteile bisweilen gebrochen hatte. Das Unpassende, was das Publikum sonst wohl in Lieutenantsverlobungen findet, fiel hier weg, da die Braut ein artiges Vermögen besaß, und nur der Eigensinn der Mutter die Heirat bis zu dem Zeitpunkte verschob, wo der Schwiegersohn einen höheren Rang, und die Kompanie erlangt haben würde.
Indessen mußte der Monarch wohl noch eine große Anzahl verdienstvollerer oder älterer Lieutenants besitzen. Das Patent blieb länger aus, als man gedacht hatte, und da die Mutter ihre Tochter durchaus nicht ohne einen klingenden Titel von ihrem Herzen weggeben wollte, so dehnten sich die Tage der Hoffnung zu Jahren der Erwartung aus. Ein zu langwieriger Brautstand hat aber die bedeutendsten Unannehmlichkeiten. Die Liebe ist für Stunden, die Ruhe für das Leben; wer kann aber der Ruhe genießen, solange die Früchte noch auf dem Halme stehn? Das Gefühl gleicht nach so gedehntem Harren einem schönen Weine, den man im offnen Glase hat fade und abschmeckend werden lassen.
Grade kurz vor der Zeit, wo dieser bedenkliche Mangel an Geschmack im Verhältnisse der Liebenden eintrat, lernte ich den Lieutenant kennen, und ward durch ihn im Hause seiner zukünftigen Schwiegermutter eingeführt. Ich sah noch die letzten Sommertage der Zärtlichkeit, bald aber nahm ich eine gewisse Kälte zwischen den Brautleuten wahr, die nur mit einem unangenehmfeurigen Wesen abwechselte. Sie ließ sich wohl, wenn er dicht bei ihr stand, durch einen andern den Mantel holen, und betonte den Befehl; er rannte mitunter in der zierlichsten Gesellschaft nach heimlich-raschem Zwiegespräch in die Ecke, wo sein Hut und Degen sich befand, und nur meine Zuredungen konnten ihn alsdann bewegen, Aufsehn zu vermeiden und zu bleiben. Denn schon war ich sein Vertrauter geworden. Als junger Arzt mußte ich mir auf jede Weise zu helfen suchen. Ich machte damals in Herzenssachen den Rat und Beistand, um stärkere Praxis zu bekommen.
Der Lieutenant bekannte mir seinen ganzen Kummer. Er könne seiner Geliebten nichts mehr recht machen. Jede Laune werde an ihm ausgelassen. Bald solle er erkaltet sein, bald sich ohne Gemüt betragen haben, neulich habe sie ihm vorgeworfen, er verstehe sie nie. Er sei wirklich noch ganz und gar der alte, gehe im Frühlinge mit dem ersten Märzenveilchen zu ihr, im Junius komme der Rosenstock, im Herbst ein Almanach an die Reihe der Geschenke, wie sonst; zum Geburtstag mache er seinen Vers, die Weihnachtsbonbonnière fehle nimmer. Aber alles werde jetzt kaltsinnig oder schnöde aufgenommen. Was er denn nur in dieser Not beginnen solle?
Ich konnte ihm freilich als einziges Mittel nur die Heirat nennen. Er versetzte, dieses stehe nicht in seiner Gewalt. Sich selber könne er nicht avancieren, und das Kriegsdepartement wolle es noch nicht.
Indessen sind solche ruhige Charaktere nur bis auf einen gewissen Punkt zu treiben, und dieser fand seinen Gleichmut wieder, als er vor seinem Gewissen sicher war, im Dienste der Liebe nicht lässig geworden zu sein. Nun verwies er seine Braut, wenn sie ohne Grund klagte, an die Vernunft. Von dieser wollte sie nichts hören. Darauf kam er mit der Notwendigkeit hervor, sich zufriedenzugeben, wenn die Dinge einmal nicht anders gehn wollten. Worauf sie ihm sagte, er sei unausstehlich. Endlich, da alle Trostgründe niedrer Schicht nichts helfen wollten, wählte er als letzte Arznei die Fügungen des Himmels. Wenn sie über ein Fältchen zuviel oder zuwenig im Kleide sich ungebärdig anstellte, sprach er, man könne nicht wissen, wozu ein Mißgeschick fromme. Wenn der Regen eine Spazierfahrt vereitelte, lehrte er, die Vorsehung lasse Tropfen fallen, damit die Sonne nachher um so herrlicher scheine. Und als sie einst weinend auf ihrem Stuhle saß, weil man den Gesang einer Mitschwester stärker beklatscht hatte, als den ihren, gab er, zu ihr tretend, den Spruch zu vernehmen: „Wen der Herr liebt, den züchtiget er!“ Er war ein ordentlicher Kirchengänger, und hatte wirklich den Glauben, daß dem Geduldigen alle üblen Sachen zum Heile ausschlagen müssen.
Zuerst war ihr dieser Ton neu, und es vergingen einige Wochen unter solchen Tröstungen ganz leidlich. Indessen wollte das Gute, zu welchem nach ihrer Meinung das Schlechte führen mußte, nämlich das Avancement, immer noch nicht erscheinen. Da ward sie böser als je, und der arme Phlegmatikus geriet in ein Fegefeuer, welches nicht läuternder sein konnte. Zu gleicher Zeit begann ein Einfluß auf sie zu wirken, welcher den Frieden zwischen beiden bald ganz aufhob.
Eine jener alten Jungfraun, welche, weil sie sitzengeblieben sind, es gern sähen, wenn das Heiraten abkäme, hatte sich des verdüsterten Sinns unsrer schönen Ärgerlichen bemächtigt. Sie ließ in ihre Gespräche einfließen, daß sie schon längst mit Kummer bemerkt, wie der Lieutenant immer gleichgültiger geworden sei, wie seine Neigung wohl keine Probe bestehen werde, und was dergleichen mehr war. Diese bösartigen Worte fanden ein offnes Ohr. Verdrießlich, von Mißstimmungen geplagt, ließ sich die Getäuschte zu dem Schritte hinreißen, dessen gefährliche Albernheit schon so viele beklagt haben. Sie wollte den Sinn ihres Liebhabers prüfen.
Eines Morgens wurde ich an das Krankenlager des Fräuleins berufen. Sie lag, anmutig gekleidet, allerdings im Bette, und klagte fast über jegliches, was den Menschen schmerzen kann. Die Mutter stand untröstlich daneben, sie liebte das Kind, vielleicht zu sehr. Man kann denken, daß mir, als jungem Arzte, eine Krankheit in einem geachteten Hause, welches selbst einigermaßen in der Mode war, höchst angenehm sein mußte, ich strengte daher die ganze Kraft meiner Diagnose, deren Feinheit man stets auf der Klinik gerühmt hatte, an, um die Natur des Übels zu entdecken. Aber der Puls ging vortrefflich, die Augen strahlten vom gesundesten Feuer, die Wangen lachten im reinen Rote der Jugend, die Zunge war unbelegt, alles, ohne Ausnahme alles befand sich leider im wünschenswertesten Zustande. Ich entschied mich, daß hier Verstellung sei, verordnete die unschuldigen Mittel, welche Hippokrates uns für einen solchen Fall an die Hand gegeben hat, äußerte indessen natürlich meine wahre Meinung nicht, sondern sagte der Mutter draußen, auf ihre ängstliche Frage: ob es auch keine Gefahr habe? mit Ernst und Nachdruck, daß man noch grade zur rechten Zeit nach mir geschickt habe, und daß eine Stunde später für nichts mehr zu stehn gewesen sei.
„Sie glauben nicht, welches Zutrauen sie zu Ihnen hat“, sagte die Mutter. „Den Geheimen Rat durfte ich nicht holen lassen.“ – „Nein“, dachte ich. „Der alte grobe Heros würde wenig Umstände gemacht haben, meine blöde Jugend ist für dergleichen Leiden geeigneter.“
Auf der Straße fand ich den Liebhaber, dem man schon durch die dritte Hand dieses Siechtum zu wissen getan hatte. Er war so bestürzt, wie es einem Seladon geziemt, und in Verzweiflung, daß er nicht gleich nach dem Hause seiner Braut eilen könne, aber er müsse auf die Parade. Ich beruhigte ihn, und verpfändete mein Ehrenwort, daß die Sache nichts weiter sei, als ein kleiner Schnupfen.
Gegen Abend fand ich mich wieder bei der verstellten Kranken ein, denn ich war neugierig, wohin diese Komödie führen werde. „Treuer, sorgsamer Freund!“ sagte die Mutter, welche von meinem Eifer gerührt war. In bescheidner Entfernung vom Krankenbette saß der Lieutenant, wie es schien, zerstreut und verlegen.
„Es ist doch ein großes Glück um einen gleichmütigen Sinn“, stichelte die Mutter. „Man versäumt dann nichts Notwendiges, und macht die Geschäfte erst ab, bevor man dem Herzen folgt.“
„Er will es nicht glauben, daß ich so krank bin, Doktor“, seufzte Fräulein Ida, deren hochrotes Antlitz von großer Bewegung zeugte. Die alte Jungfer saß im Fenster und strickte für die Armen.
Diesmal erriet meine Diagnose die Krankheit. Mich gelüstete nach der Krisis, und da ich als junger Arzt, traurig für mich, überflüssige Zeit hatte, setzte ich mich zu den gesunden Damen, und knüpfte mit ihnen eins der Gespräche an, aus welchem man noch immer mit Geistesfreiheit nach etwas andrem hinzuhören vermag.
„Wenn ich sterbe, Fabian …“ lispelte das Fräulein. „Teure Ida, an einem Schnupfen stirbt man ja nicht“, versetzte freundlich aber gefaßt der Lieutenant.
Sie begann immer heftiger und weinerlicher zu reden, kam in den Ton der Jean Paulischen Liane, sagte, im Traume sei ihr ihre selige Caroline erschienen, und sprach viel von Ahnung und Vorgefühl.
Ich saß so, daß ich im Spiegel die Szene beobachten konnte. Je pathetischer das Fräulein wurde, desto mehr nahm das Gesicht des Bräutigams den Ausdruck der Abwesenheit an, er half sich fast nur noch mit Interjektionen, als: „Hm! So! Ei bewahre!“ Nachmals hat er mir gestanden, daß er an dem Tage einen Verdruß mit seinem Obersten gehabt habe, und daß seine Gedanken freilich mehr bei dem ungerechten Vorgesetzten, als bei dem Schnupfen des Fräuleins gewesen seien.
In einem solchen Zustande laufen einem gewisse Redensarten, die man häufig im Munde führt, ohne Sinn und Verstand über die Lippen. Daher geschah es, daß, als das Fräulein, welche über die Fassung ihres Geliebten immer mehr aus der Fassung geriet, mit unterdrücktem Weinen sagte: „Ja, ich empfinde ein gewisses Etwas in mir, ein Weben der Auflösung, die schwarzen Männer werden mich gewiß wegtragen“ – der Lieutenant, der schon lange nicht mehr wußte, wovon die Rede war, zerstreut und feierlich ausrief: „Wie Gott will! Der Wille des Herrn geschehe!“
Schrecklich war die Wirkung dieser Worte. Das Fräulein, entrüstet über eine solche Ergebung in die Fügungen des Himmels, die doch gar zu weit ging, warf meine unschuldige Medizinflasche zu Boden, daß die Scherben umherflogen, und rief:
„Aus meinen Augen! Ich habe dich durchschaut! Fort! Wir sind für immer geschieden!“ – „Wenn meine Tochter stirbt, sind Sie ihr Mörder“, wehklagte die Mutter. Die alte Jungfer hatte ihr Strickzeug in den Schoß sinken lassen, und äußerte so mit Salbung: daß derjenige zu beneiden sei, der so früh, wie Ida, die Einsicht in die Nichtigkeit aller Erdenlust gewinne.
„Erlauben Sie mir nur einige Worte zu meiner Verteidigung …“ stammelte der arme Fabian. „Es ist jetzt nicht Zeit dazu, machen Sie, daß Sie fortkommen“, raunte ich ihm zu.
Ich war mit den Damen allein. „Ida! meine Ida!“ seufzte die Mutter. „Diese Gemütserschütterung in deinen Leiden! Erhole dich, mein Kind, denke nicht mehr an den Abscheulichen.“ – Ich beschloß, die kleine Heuchlerin zu strafen, und die alte Jungfer dazu. Und so ist es gekommen. Ich erklärte den Zustand des Fräuleins für verschlimmert, ich ernannte die bejahrte Freundin zur nächtlichen Wächterin, da die Mutter eine solche Anstrengung nicht aushalten könne. Drei Tage mußte die gesunde Kranke im Bett zubringen, drei Nächte hatte die Friedensstörerin auf dem Wächterstuhl zu versitzen. Endlich erklärte jene sich mit Gewalt für hergestellt, zuletzt lief diese aus dem Hause und verschwor, es wieder zu betreten, wenn ich dort aufgenommen bleibe. Darüber bekam sie mit der Mutter Streit und Feindschaft, die mich einen seltnen Menschen nannte. Kurz, der böse Feind hatte sich diesmal die Grube selbst gegraben.
Mehrere Wochen vergingen, in denen ich nichts von meinen Liebesleuten hörte. Einige wirkliche und zwar sehr ernste Krankheiten hatten meine ganze Zeit in Anspruch genommen.
An einem schönen Märztage wanderte ich über den neuen Kirchhof, wo alle Sträucher in dem ungewöhnlich frühwarmen Wetter schon die Knospenaugen aufschlugen. Ich wollte die neuen Einrichtungen im Leichenhause besichtigen, welche zur Rettung der Scheintoten angebracht worden waren. Soeben mit dem Meisterdiplom versehen, hatte ich, die Obsorge über jene Anstalten zu führen, von der Stadt den Auftrag bekommen. Als ich durch die gewundenen, mit Kies reinlich gefesteten Wege des parkartigen Gottesackers ging, und das im gefälligen Stil erbaute Leichenhaus hinter einem Rasenplatze liegen sah, sagte ich: „Es ist kein Wunder, daß die Menschen jetzt mit dem Leben unzufrieden sind, man macht die Sterbehäuser und Grabstätten zu anlockend.“
Auf einem freien Platze fand ich unvermutet meinen Phlegmatikus. Er stand bei einem Sträußermädchen, die ihren Korb voll Frühlingsblumen ihm vorhielt. Er wählte und suchte sich das Schönste, was sie an Veilchen, Primeln und Aurikeln hatte, zusammen. „Für wen der Strauß?“ fragte ich. „Für Ida“, versetzte er.
„Gottlob! So seid ihr versöhnt?“
„Ach nein! Ich habe sie nicht wiedergesehn. Aber es ist heute ihr Geburtstag. Ich will den Strauß unter ihrem Porträt in Wasser setzen.“
Er sprach diese Worte ruhig, ja kalt. Aber seine Augen waren erloschen, und die Wangen bleich. Ich muß gestehn, daß mich die stummen, geduldigen Patienten immer am meisten zur Teilnahme bewegt haben. Ich sah meinen armen Verstoßnen an, ich überlegte hin und her, ob hier nicht mit einem raschen Streiche zu helfen sei? Die Natur der Leidenschaften, insbesondre der Liebe, kannte ich aus der Seelenlehre, das Fräulein war mit der Mutter in der Stadt, das wußte ich. Ich war jung, verwegen! Ohne an die möglichen Folgen eines tollen Einfalls zu denken, lud ich den Lieutenant ein, sich von mir in die Rettungsanstalten zeigen zu lassen. Das Sträußermädchen wies ich an, vor der Türe zu warten.
Der Wächter war ausgegangen; alles begünstigte meinen Plan. Ich öffnete mit dem Hauptschlüssel, wir waren allein im leeren, schallenden Hause. Ich erklärte meinem Begleiter jedes Ding: die Einrichtung und Verbindung der Gemächer, die leicht zu bewegenden Glockenzüge, die Wärmmaschinen, die Frottierzeuge, die Bürsten, den Elixier- und Essenzenapparat des Wächters für die ersten Augenblicke des Erwachens aus dem furchtbaren Schlummer. Er fragte, ernst und wissenschaftlich gesinnt, verständig nach allem, und keine empfindsame Betrachtung kam in diesem Hause des Todes über seine Lippen. Endlich sagte er scherzend: „Diese reinlichen schimmernden Wände, die bronzenen Lampen, die blinkenden Stahlgriffe, die schönen Teppiche und Matratzen zeigen, wie jetzt alles auch bei den schrecklichsten Dingen zum Bequemen und Geschmückten strebt. Es fehlen nur noch die Tische mit den Journalen, um den Geretteten Unterhaltung zu bereiten, bis die Ihrigen sie wieder abholen.“
Ich bat mir seinen Verlobungsring aus. Er stutzte, wußte nicht, was ich wollte. Ich erklärte ihm trocken, daß ich gesonnen sei, noch heute zwischen ihm und seiner Braut dauerhaften Frieden zu stiften, aber dazu des Ringes bedürfe, nahm ihn bei der Hand, und streifte mit freundschaftlicher Gewalt ihm den Ring vom Finger. Er, in plötzlich auflodernder Hoffnung und Freude, rief: ob ich verwirrt sei? Ich, ohne zu antworten, schrieb mit Bleifeder auf ein ausgerißnes Blättchen meines Portefeuilles ein paar Zeilen an die Schwiegermutter, legte den Ring bei, verschloß das Billet mit Oblate, eilte zum Mädchen hinaus, sagte ihr, den Herrn habe ein Nervenschlag betroffen, sie sollte das Briefchen auf der Stelle da und da hintragen.
Mein bestürzter Freund war bis auf den Flur gefolgt, und hatte die Bestellung gehört. Ich nötigte ihn in eine der angenehmsten Sterbekammern zurück. „Um Gotteswillen!“ rief er, „was treiben Sie? was machen Sie aus mir?“ – „Einen Scheintoten“, versetzte ich. Er sah mich an, wie einen, von dem man glaubt, er habe den Verstand verloren. „Idas Krankheit“, sagte ich, „führte den Bruch herbei. Ihr Tod soll das Bündnis herstellen; das nennt man einen Klimax, welcher zu den wirksamsten Redefiguren gehört. Sie haben die Wahl, entweder mich zuschanden zu machen und sich jede Aussicht zu verbaun, oder folgsam zu sein, und Ihr Glück im letzten Akt einer Posse zu empfangen.“ Er stand anfangs starr, dann verwünschte er meine Torheit, und überschüttete mich mit Vorwürfen. Ich behielt indessen Geistesgegenwart, kramte Schnepper und Bindzeug aus, setzte eine Menge Flaschen auf den Tisch, ließ den Essigäther duften, verbrannte Federn, kurz, ich richtete das Zimmer so zu, daß es ganz medizinisch aussah und roch. Er, über meine Kaltblütigkeit in Verzweiflung, warf sich auf eine Matratze. Ich erklärte ihm, da könne er liegenbleiben, denn dahin gehöre er in seinem jetzigen Zustande. Ich löste seine Halsbinde, knöpfte die Uniform und Weste auf, und machte mir immerfort zu schaffen, um meine Unruhe zu verbergen, die sich mit dem Nachdenken doch allmählich bei mir einzustellen begann.
Nach einiger Zeit sprang er auf, und rief: „Ich muß fort, ich bin an diesen Dingen unschuldig! Sehen Sie zu, wie Sie aus der Verlegenheit kommen, die Sie angerichtet haben.“
Ein Wagen fuhr sturmschnell vor. „Sie kommen“, rief ich, „ich wußte das ja!“ und ging ihnen entgegen. Sie waren es, Ida und ihre Mutter, meine Berechnung war richtig gewesen. Aus dem Schlage stürzte das Fräulein entgeistert, blaß, die Augen voll Tränen, und rief: „Wo ist seine Leiche?“ – „Er lebt, beruhigen Sie sich, er ist erwacht, meine Furcht war zu voreilig!“ rief ich ihr hastig zu. „Wo? Wo?“ stammelte sie, flog in das Haus, und wie durch Instinkt geleitet, in das rechte Zimmer.
Ich half der Mutter aus dem Wagen. Sie wußte sich in diesen Wechsel von Trauer und Freude nicht zu finden. „Teuerster, warum erschreckten Sie uns? Man muß bei dergleichen doch erst das Ende abwarten“, sagte sie. Ich bat um Verzeihung, ich hätte ganz den Kopf verloren gehabt, sie möchte einem jungen unerfahrnen Manne um des glücklichen Ausgangs willen nicht zürnen.
Wir traten in die Sterbekammer. Da war die Liebe von den Toten auferstanden. Fabian und Ida lagen einander in den Armen. Sie herzten sich und küßten sich, und wußten beide nicht, was sie taten. Sie wollte von ihm wissen, wie ihm zumute gewesen sei? er erwiderte, in diesem Punkte besonnen, er wisse von nichts, sie müsse den Doktor fragen.
Ich verbot alle Erklärungen, und riet ihnen, sich des Lebens zu freun. Die Mutter trat hinzu, gab ihm die Hand, und sagte sehr freundlich: „Lieber Sohn, Sie machen uns schöne Streiche. Mein Gott, wie das hier aussieht und riecht, es fällt mir auf die Nerven. Verlassen wir den leidigen Ort.“ Ich benutzte den Augenblick, küßte ihr ehrerbietig die Hand, und sagte bescheiden: „Edle Frau! Ida ist vor Liebe krank geworden, Fabian wäre beinahe daran gestorben; sollen Ihre Kinder noch länger schmachten?“
Die Gewalt dieser Auftritte hatte sie erweicht. Sie gab die Zustimmung zu dem, was die Verlobten wünschten. Es folgte ein neuer Sturm von Liebkosungen und Umarmungen, in dem ich ebenfalls zuletzt von ohngefähr mehrere Küsse bekam.
Indessen waren die Fügungen des Himmels auch tätig gewesen. Denn als wir eben aus dem seltsamsten aller Boudoire aufzubrechen im Begriff standen, nahte sich der Bursche Fabians mit der in gemeßner Haltung vorgebrachten Meldung, daß der Oberst schon dreimal nach ihm geschickt habe, indem das ersehnte Patent nun endlich eingetroffen sei.
So führte Ida statt eines erblichnen Lieutenants, nach dem sie ausgefahren war, einen lebendigen Capitain nach Hause. – Sie leben sehr glücklich miteinander, manche Szene, die sonst in die Ehe fällt, haben sie vorher schon unter sich abgetan, dazu ist wenigstens der lange Brautstand dienlich gewesen.
Mir brachte die sorgsame Behandlung des Fräuleins während jener drei Tage und die Rettung des Bräutigams große Gunst in den vielen mit dem Hause verbundnen Familien zuwege. Einer lobte mich immer noch mehr als der andre, so entstand mir bald ein Ruf, den mir so manche an armen Leuten im Verborgnen geübte saure Mühe nicht erworben hatte. Zuerst schlug mich das Gewissen etwas, nachher beruhigte ich mich durch den Anblick der allgemeinen Scharlatanerie, die in der Welt herrscht, über die meinige, die wenigstens niemand geschadet, vielmehr eine zufriedne Ehe gestiftet hat.
Bilder: Rainer V.: Salzkotten, ca. 2011 bis 2015.
Der Soundtrack ist Blast, Musikanten (Epistel 4) aus der dem Thema entsprechenden CD Liebe, Schnaps, Tod – Wader singt Bellman von dem bekannten Ostwestfalen Hannes Wader (gebürtig aus Bielefeld-Gadderbaum), 1996. Die Lieder sind, wie der Untertitel sagt, nicht von Wader selbst, sondern dem verstorbenen Schweden Carl Michael Bellman (1740 bis 1795), haben in Waders gesammelter Aufbereitung aber das Zeug zur Lieblings-CD. Waders eigene Übersetzung von Hej Musikanter ge Valdthornen väder wurde unterstützt von Reinhard Mey und Klaus Hoffmann.
Du bist’s (Er ist’s)
Update zu Das Leben ist kein [Zutreffendes streichen]:
Ich weiß, wie lange man an einen Comic hinzeichnet: Den ganzen Comic-Bloggern, die ihren Alltag darstellen, kann nichts anderes übrig bleiben als Metakram. Gut, dass Sarah Burrini wenigstens noch mit einem Elefanten, einem Pony, einem Fliegenpilz und so einem Dings zusammenlebt.
——— Eduard Mörike:
Er Ist’s.
aus: Maler Nolten. Novelle in zwei Teilen. 2. Teil, 1829, G. J. Göschen’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1832:
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s,
Frühling, ja du bist’s!Dich hab’ ich vernommen!
Der vorletzte Vers ist übrigens ab dem Erstdruck im Maler Nolten verdoppelt: „Frühling, ja du bist’s! / Frühling, ja du bist’s!“ Das gibt noch viel Emendationsarbeit, ab wann das nur noch einfach ausgerufen wird; spätestens in den Gesammelten Schriften 1878 jedenfalls. In drei Strophen aufgeteilt wie in der Gedichtsammlung 1838 find ich’s am schönsten.
Außerdem erfreut es immer das Herz, zu beobachten, wie die alten Meister (*1804) jungen Menschen (*1979) im Bewusstsein geblieben sind, die ich mal als Letzter vor Verleihung des PENG!-Preises (2011) sprechen durfte.
Bilder: Frühüling, 9. Mai 2016; G. J. Göschen’sche Verlagshandlung 1829/1878;
leiser Harfenton ohne falsche Scheu vor der Singenden Säge: Tom Waits: You Can Never Hold Back Spring, aus: Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, 2006.
Oh my, oh my, oh my, what if it was true? (O wolle nicht ergründen, was einmal unergründlich ist)
Update zu Denkst du denn nicht an den Loup Garou?
und Ach! wie ists erhebend sich zu freuen:
Oh my, oh my, oh my, what if it was true?
And oh my, oh my, oh my, tell me is it true?
Did he, did he, did he die upon that cross?
And did he, did he, did he come back across?Violent Femmes: Jesus Walking on the Water, 1984.
Am I a soldier of the cross,
A follower of the Lamb,
And shall I fear to own His cause,
Or blush to speak His name?Carter Family: On the Sea of Galilee, 1932.
Vnd da der Sabbath vergangen war, kaufften Maria Magdalena, vnd Maria Jacobi vnd Salome specerey, auff das sie kemen, vnd salbeten jn. Vnd sie kamen zum Grabe an einem Sabbather seer fruee, da die sonne auffgieng. Vnd sie sprachen vnternander, Wer waltzet vns den stein von des Grabs thuer? Vnd sie sahen dahin, vnd wurden gewar, das der Stein abgeweltzet war, denn er war seer gros.
VNd sie giengen hin ein in das Grab, vnd sahen einen Juengling zur rechten hand sitzen, der hatte ein lang weis Kleid an, vnd sie entsatzten sich.
Er aber sprach zu jnen, Entsetzet euch nicht. Jr suchet Jhesum von Nazareth den gecreutzigten, Er ist aufferstanden, vnd ist nicht hie, Sihe da, die Stete, da sie jn hinlegten. Gehet aber hin, vnd sagts seinen Juengern, vnd Petro, Das er fur euch hingehen wird in Galilea, Da werdet jr jn sehen, wie er euch gesagt hat.
Markus 16,1–7, Lutherbibel 1545.
Weil man sich ab heute wieder über seine Religion freuen darf, gleich meinen besten Osterwitz — und davon kenn ich nicht viele:
Jesus zeigt sich nach der Auferstehung seinen Jüngern: „Grüß euch, Jungs, da bin ich wieder.“
Sagt der ungläubige Thomas: „Soso? Und wer sagt uns, dass du Jesus bist?“
„Wer soll ich denn sonst sein?“
„Jesus ist doch vorgestern gestorben, wir haben doch zugeschaut.“
„Ja, und heute früh bin ich auferstanden. Das ist ja das Wunder.“
Sagt Thomas: „Wenn du Jesus bist, kannst du auch übers Wasser laufen. Da ist der See.“
Jesus geht zum See und läuft übers Wasser. Nach fünf Metern macht es flump und Jesus ist unter Wasser verschwunden.
Taucht Jesus wieder auf, paddelt und prustet: „Ey verdammt, ich hab doch noch die Löcher in den Füßen.“
Den letztzitierten Evangelientext stellte die Droste ihrem Ostersonntagsgedicht im Geistlichen Jahr voran. Dazu verwendete sie mutmaßlich die Fassung des im Bistum Münster gebräuchlichen Perikopenbuchs, uns ist nur die Luther-Fassung letzter Hand 1545 zugänglich.
Dafür sind wir in der glücklichen Lage, die zwei schönsten Osterlieder der Musikgeschichte voran- und sogar hintanzustellen: On the Sea of Galilee — ein frommes, hörbar hausgemachtes Gospelchen von ergreifender Schlichtheit — und Jesus Walking on the Water — unklarer Richtung; wahrscheinlich Gothic Beach Hillbilly, falls das schon erfunden ist. Für nur eins davon würde manch einer dreieinhalb Stunden Bach-Passion kalt stehenlassen.
——— Annette von Droste-Hülshoff:
Am Ostersonntag
aus: Geistliches Jahr in Liedern für alle Sonn- und Festtage, 1820,
Erstdruck: Cotta, Stuttgart und Tübingen 1851, cit. nach der Insel-Gesamtausgabe:
O, jauchze, Welt, du hast ihn wieder,
Sein Himmel hielt ihn nicht zurück!
O jauchzet! jauchzet! singet Lieder!
Was dunkelst du, mein seelger Blick?Es ist zu viel, man kann nur weinen,
Die Freude steht wie Kummer da;
Wer kann so großer Lust sich einen,
Der all so große Trauer sah!Unendlich Heil hab‘ ich erfahren
Durch ein Geheimnis voller Schmerz,
Wie es kein Menschensinn bewahren,
Empfinden kann kein Menschenherz.Vom Grabe ist mein Herr erstanden
Und grüßet alle die da sein,
Und wir sind frei von Tod und Banden,
Und von der Sünde Moder rein.Den eignen Leib hat er zerrissen,
Zu waschen uns mit seinem Blut,
Wer kann um dies Geheimnis wissen,
Und schmelzen nicht in Liebesglut!Ich soll mich freun an diesem Tage
Mit deiner ganzen Christenheit,
Und ist mir doch, als ob ich wage,
Da Unnennbares mich erfreut.Mit Todesqualen hat gerungen
Die Seligkeit von Ewigkeit,
Gleich Sündern hat das Graun bezwungen
Die ewige Vollkommenheit.Mein Gott, was konnte dich bewegen
Zu dieser grenzenlosen Huld!
Ich darf nicht die Gedanken regen
Auf unsre unermeßne Schuld.Ach, sind denn aller Menschen Seelen
Wohl sonst ein überköstlich Gut,
Sind sie es wert, daß Gott sich quälen,
Ersterben muß in Angst und Glut!Und sind nicht aller Menschen Seelen
Vor ihm nur eines Mundes Hauch?
Und ganz befleckt von Schmach und Fehlen,
Wie ein getrübter dunkler Rauch?Mein Geist, o wolle nicht ergründen,
Was einmal unergründlich ist;
Der Stein des Falles harrt des Blinden,
Wenn er die Wege Gottes mißt.Mein Jesus hat sie wert befunden
In Liebe und Gerechtigkeit;
Was will ich ferner noch erkunden?
Sein Wille bleibt in Ewigkeit!So darf ich glauben und vertrauen
Auf meiner Seele Herrlichkeit!
So darf ich auf zum Himmel schauen
In meines Gottes Ähnlichkeit!Ich soll mich freun an diesem Tage;
Ich freue mich, mein Jesu Christ,
Und wenn im Aug‘ ich Tränen trage,
Du weißt doch, daß es Freude ist!
Soundtracks: The Original Carter Family: On the Sea of Galilee, 1932;
Violent Femmes: Jesus Walking on the Water, aus: Hallowed Ground, 1984.
Bild: Simerenya: C. Timmann — Delfow, 16. März 2016. Etwas Genaueres finde ich darüber nicht einmal über TinEye heraus. Wenn Sie mehr über Maler, Bild oder Genre wissen, machen Sie um Himmels willen kein Geheimnis draus.
Wenn man etwas Bildung hat (Die Moritat vom jungen Friedrich Kolbe)
Update zur Eskimojade:
Mein lyrisches Frühwerk hat sich immer wie Wilhelm Busch angehört, weshalb ich es heute nicht mehr eigens verbreiten muss. Besonders beeindruckt hat mich in den zwei Bänden Was beliebt, ist auch erlaubt und Und die Moral von der Geschicht, die es seit 1959 unverändert mit dem Vorwort von Theodor Heuss gibt, Trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung, das ich zehnjährig für einen echten Krimi gehalten hab. Allein der Formulierung der Überschrift nach zu schließen, ist es aber eher die Parodie auf eine Moritat und tatsächlich auf so ziemlich jede Melodie cantabile. — Und was heißt hier überhaupt, die haben Sie nicht, die einzige Gesamtausgabe, die wirklich überall hingehört, wo jemand wohnt, der lesen kann? Klick und kaufen, aber zügig!
Wilhelm Busch hat sich durchgehend mit einiger Koketterie als Kauz und „eingefleischten Junggesellen“ — was zeitweise eine feine Umschreibung für „schwul“ war — dargestellt. Die Moritat schrieb er mit 28 Jahren, da klang er, man weiß nicht, mit wie viel Ironie, geradezu frühvergreist. Trotzdem ist sie deutlich ein Steinbruch an Motiven für das spätere Max und Moritz, 1865: Der Schneider heißt Böckel statt später Böck, wird aber ebenfalls mit „Meck, meck, meck“ gemobbt; Antiheld Fritzchen hat Pausbacken und Strubbelfrisur der späteren Max-Figur und die Hosen von Moritz, die hier allerdings eine handlungstragende Rolle spielen (siehe Gudrun Schury: Ich wollt, ich wär ein Eskimo. Das Leben des Wilhelm Busch. Aufbau Verlag, Berlin 2007, als Taschenbuch in: Aufbau-Taschenbücher Nr. 7071, Berlin 2010).
Die vermittelten moralischen Werte — weil „Moritat“ entweder von „Moralität“ oder „Mordtat“ kommt — erscheinen heute fragwürdig. Das ist ja gerade die Gaudi. Ich bringe den Text korrigiert nach der Erstveröffentlichung in den Fliegenden Blättern, die sich von den erhältlichen, gefällig geglätteten am stärksten in der Zeichensetzung unterscheidet.
——— Wilhelm Busch:
Trauriges Resultat
einer vernachläßigten Erziehung
in: Fliegende Blätter 33.1860, Nr. 783—808, Seite 108 bis 111., 1860:
Ach, wie oft kommt uns zu Ohren,
Daß ein Mensch was Böses that,
Was man sehr begreiflich findet,
Wenn man etwas Bildung hat.Manche Eltern sieht man lesen
In der Zeitung früh bis spät ;
Aber was will dies bedeuten,
Wenn man nicht zur Kirche geht ?Denn man braucht nur zu bemerken,
Wie ein solches Ehepaar
Oft sein eig’nes Kind erziehet,
Ach, das ist ja schauderbar !Ja, zum In’stheatergehen,
Ja, zu so was hat man Zeit,
Abgeseh’n von and’ren Dingen,
Aber wo ist Frömmigkeit ?
Zum Exempel, die Familie,
Die sich Johann Kolbe schrieb,
Hatt‘ es selbst sich zuzuschreiben,
Daß sie nicht lebendig blieb.Einen Fritz von sieben Jahren
Hatten diese Leute blos,
Außerdem, obschon vermögend,
Waren sie ganz kinderlos.Nun wird mancher wohl sich denken :
Fritz wird gut erzogen sein,
Weil ein Privatier sein Vater ;
Doch da tönt es leider : Nein !Alles konnte Fritzchen kriegen,
Wenn er seine Eltern bat,
Äpfel=, Birnen=, Zwetschgenkuchen,
Aber niemals guten Rath.
Das bewies der Schneider Böckel,
Wohnhaft Nr. 5 am Eck ;
Kaum, daß dieser Herr sich zeigte,
Gleich schrie Fritzchen : meck, meck, meck !Oftmals, weil ihn dieses kränkte,
Kam er und beklagte sich,
Aber Fritzchens Vater sagte :
Dieses wäre lächerlich.Wozu aber soll das führen,
Ganz besonders in der Stadt,
Wenn ein Kind von seinen Eltern
Weiter nichts gelernet hat ?So was nimmt kein gutes Ende. —
Fast verging ein ganzes Jahr,
Bis der Zorn in diesem Schneider
Eine schwarze That gebar.
Unter Vorwand eines Kuchens
Lockt er Fritzchen in sein Haus,
Und mit einer großen Scheere
Bläst er ihm das Leben aus.Kaum hat Böckel dies verbrochen,
Als es ihn auch schon schenirt,
Darum nimmt er Fritzchens Kleider,
Welche grün und blau karirt.Fritzchen wirft er schnell ins Wasser,
Daß es einen Plumpser thut,
Kehrt beruhigt dann nach Hause,
Denkend : So, das wäre gut !Ja, es setzte dieser Schneider
An die Arbeit sich sogar,
Welche eines Tandlers Hose
Und auch sehr zerrissen war.
Dazu nahm er Fritzchens Kleider,
Weil er denkt : dich krieg‘ ich schon !
Aber ach ! ihr armen Eltern,
Wo ist Fritzchen, euer Sohn ?In der Küche steht die Mutter,
Wo sie einen Fisch entleibt,
Und sie macht sich große Sorge :
Wo nur Fritzchen heute bleibt ?Als sie nun den Fisch aufschneidet,
Da war Fritz in dessen Bauch. —
Todt fiel sie in’s Küchenmesser
Fritzchen war ihr letzter Hauch.Wie erschrack der arme Vater,
Der g’rad‘ eine Prise nahm ;
Heftig fängt er an zu niesen,
Welches sonst nur selten kam.
Stolpern und durch’s Fenster stürzen,
Ach, wie bald ist das gescheh’n !
Ach ! und Fritzchens alte Tante
Muß auch g’rad‘ vorüber geh’n.Dieser fällt man auf den Nacken,
Knacks ! da haben wir es schon !
Beiden theuren Anverwandten
Ist die Seele sanft entfloh’n.D’rob erstaunten viele Leute
Und man munkelt allerlei,
Doch den wahren Grund der Sache
Fand die wack’re Polizei.Nämlich Eins war gleich verdächtig :
Fritz hat keine Kleider an !
Und wie wäre so was möglich,
Wenn es dieser Fisch gethan ?
Lange fand man keinen Thäter,
Bis man einen Tandler fing,
Der, es war ganz kurz nach Ostern,
Eben in die Kirche ging.Ein Gensdarm, der auf der Lauer,
Hatte nämlich gleich verspürt,
Daß die Hose dieses Tandlers
Hinten grün und blau karirt.Und es war ein dumpf‘ Gemurmel
Bei den Leuten in der Stadt,
Daß ’ne schwarze Tandlersseele
Dieses Kind geschlachtet hat.Hochentzücket führt den Tandler
Man zur Exekution ;
Zwar er will noch immer mucksen,
Aber Wupp ! da hängt er schon. —
Nun wird Mancher hier wohl fragen :
Wo bleibt die Gerechtigkeit ?
Denn dem Schneidermeister Böckel
Thut bis jetzt man nichts zu leid.Aber in der Westentasche
Des verstorb’nen Tandlers fand
Man die Quittung seiner Hose
Und von Böckel’s eig’ner Hand.Als man diese durchgelesen,
Schöpfte man sogleich Verdacht
Und man sprach zu den Gensdarmen:
Kinder, habt auf Böckel acht !Einst geht Böckel in die Kirche.
Plötzlich fällt er um vor Schreck,
Denn ganz dicht an seinem Rücken
Schreit man plötzlich : Meck, meck, meck !Dies geschah von einer Ziege ;
Doch für Böckel war’s genug,
Daß sein schuldiges Gewissen
Ihn damit zu Boden schlug.
Ein Gensdarm, der dies verspürte,
Kam aus dem Versteck herfür,
Und zu Böckel hingewendet
Sprach er : Böckel geh‘ mit mir !Kaum noch zählt man 14 Tage,
Als man schon das Urtheil spricht :
Böckel sei auf’s Rad zu flechten.
Aber Böckel liebt dies nicht.Ach ! die große Schneiderscheere
Ließ man leider ihm, und Schnapp !
Schnitt er sich mit eig’nen Händen
Seinen Lebensfaden ab.
Ja, so geht es bösen Menschen.
Schließlich kriegt man seinen Lohn.
Darum, o ihr lieben Eltern,
Gebt doch Acht auf Euern Sohn.
Bilder: Universitätsbibliothek Heidelberg: Heidelberger historische Bestände — digital. Abermals danke, danke, danke für dieses Projekt samt den sorgfältigen Scanner — den viereckigen wie den zweibeinigen — in einem anständigen Kontrast:

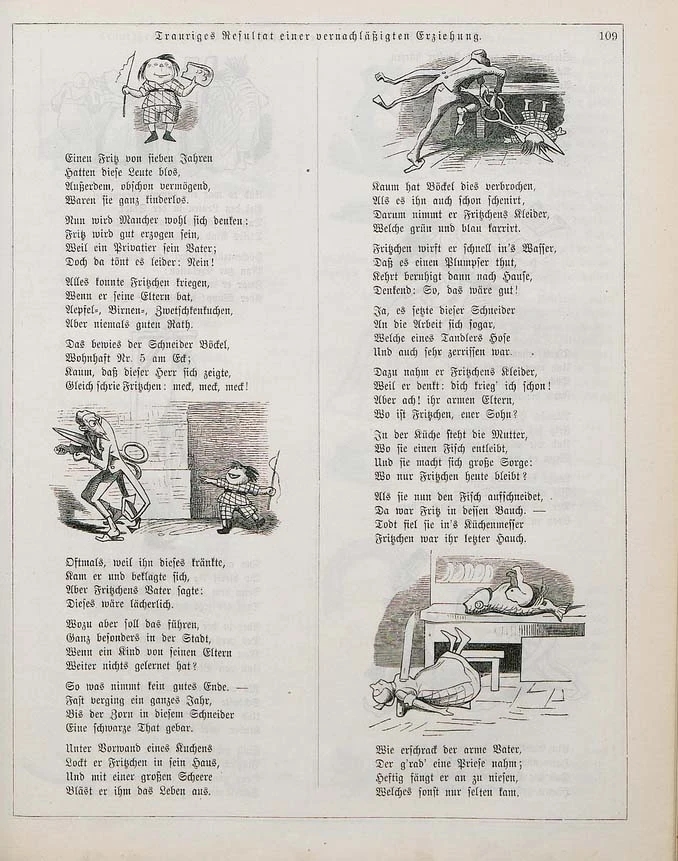
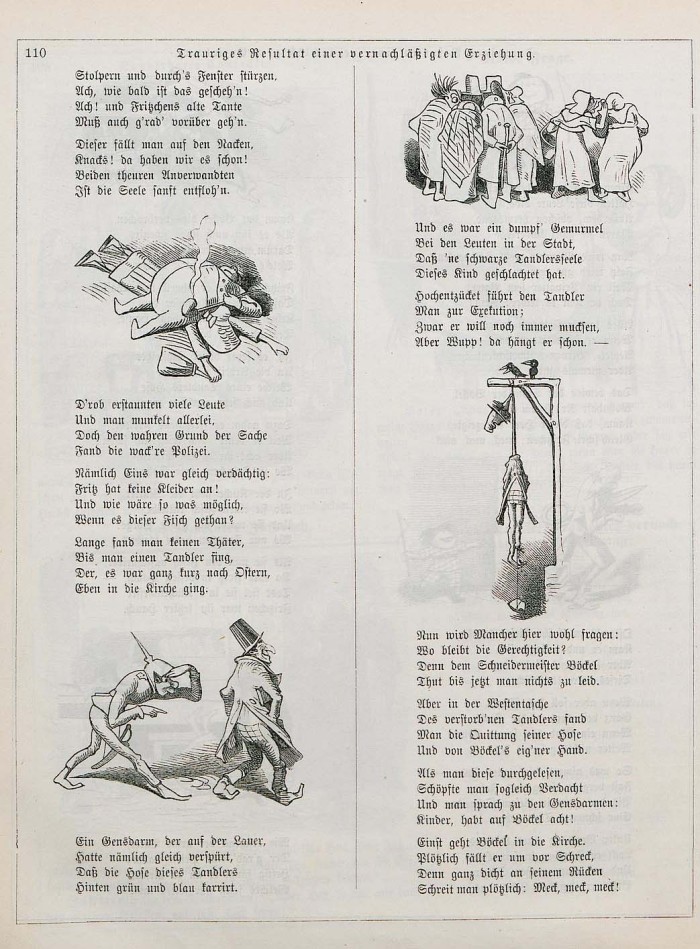

Soundtrack: Danse macabre auf Orchestrion, restauriert 2013.
Ach! wie ists erhebend sich zu freuen
Update zu Denkst du denn nicht an den Loup Garou?:
Diese Woche hab ich mir endlich die Insel-Gesamtausgabe von der Droste angeschafft, meine ersten nicht-antiquarischen Bücher seit ungefähr einem Jahrzehnt. Erstens weil die textgleich mit der in der Bibliothek Deutscher Klassiker ist, also Gott, und man mit den zwei handlichen Bänden etwas Neues auf den Weg der fata setzt, den alle libelli habent, wenn dermaleinst der Urenkel nichts mehr von dergleichen wissen will. Das kostet keinen Fünfziger, also ungefähr ein Viertel vom Original beim Deutschen Klassiker Verlag, und ist immer noch Dünndruck, insgesamt ziemlich genau 2000 Seiten in Leineneinband plus durchsichtigem Plastik im bombig festen Schuber. Goldene Lesebändchen, geliebte Freunde.
 Zweitens weil das alles Ausreden sind, ich am Sonntag in Meersburg (das am Bodensee, nicht das Merseburg mit den Zaubersprüchen) einbestellt bin, um den 70. Geburtstag meiner Mutter — lange soll sie leben — nachzufeiern, und wenn ich da schon mal hin muss, schlecht wieder gehen kann, ohne mich durchs Fürstenhäusle der Freifrau von Droste zu Hülshoff führen zu lassen, wie selbst meine Herren Eltern — lange sollen sie leben — einsehen werden. Irgendwie muss der Tag ja rumgehen, und warum soll man sich um den Preis für eine Zugfahrt sinnlos um seine erreichten vs. seine, sagen wir: erst noch zu erreichenden Lebensziele herumstreiten, wenn man buchstäblich das Zeug für eine literarische Touristenführung mitbringt — frisch über den örtlichen Buchhandel erworben — gegen die nicht mal Eltern was haben können? — Und warum es so kommen würde? Lange Geschichte.
Zweitens weil das alles Ausreden sind, ich am Sonntag in Meersburg (das am Bodensee, nicht das Merseburg mit den Zaubersprüchen) einbestellt bin, um den 70. Geburtstag meiner Mutter — lange soll sie leben — nachzufeiern, und wenn ich da schon mal hin muss, schlecht wieder gehen kann, ohne mich durchs Fürstenhäusle der Freifrau von Droste zu Hülshoff führen zu lassen, wie selbst meine Herren Eltern — lange sollen sie leben — einsehen werden. Irgendwie muss der Tag ja rumgehen, und warum soll man sich um den Preis für eine Zugfahrt sinnlos um seine erreichten vs. seine, sagen wir: erst noch zu erreichenden Lebensziele herumstreiten, wenn man buchstäblich das Zeug für eine literarische Touristenführung mitbringt — frisch über den örtlichen Buchhandel erworben — gegen die nicht mal Eltern was haben können? — Und warum es so kommen würde? Lange Geschichte.
Die historisch-kritische Gesamtausgabe der Briefe, herausgegeben von Winfried Woesler, wenn ich schon drüber bin, ist das feine dicke dtv-Taschenbuch, nach dem sich das gar nicht genug zu lobende Unternehmen Annette von Droste-Hülshoff in Briefen richtet, aber leider im Buchhandel vergriffen, weswegen ich die hoffentlich gerade noch rechtzeitig im Briefkasten hab, bevor ich mich nach Meersburg aufmachen muss.
Im Fall der Briefausgabe könnte es eventuell dem Frieden dienen, wenn ich sie nicht mitnehmen kann, weil ich den Fremdenführer unfehlbar fragen werde, warum überall, wo es um Tourismus geht, verbreitet wird, die Droste hätte sich ihr schmuckes Fürstenhäusle von 400 Talern Honorarvorschuss für Die Judenbuche gekauft, und überall, wo es um Literaturgeschichte geht, „im Vorgriff auf das in Aussicht gestellte Honorar für 400 Taler“ für ihre zweite Gedichtsammlung. Es ist aber schon wurscht, weil auch in der Insel-Ausgabe, übrigens herausgegeben von Bodo Plachta und genau demselben Winfried Woesler, die ich schon hab und mitzuführen gedenke, das mit der Gedichtsammlung drinsteht, Anmerkungsteil Seite 699. Man will ja nicht klugscheißen, und ob es gedeihlicher ist, sich mit seinen Eltern herumzustreiten oder mit einem Fremdenführer, der am Ende noch befugt ist, einen höflich aus seiner Fremdenführung zu entfernen, will ich gar nicht wissen.
 Weiter mit Inhalt. Warum die einzige anständige Briefausgabe der Droste eine einzige Besprechung auf Amazon.de hat (5 Sterne) und Der Schwarm von Frank Schätzing deren 1321, weiß ich auch nicht, aber es beschleunigt die Meinungsbildung ungemein. Es rezensiert der evangelische Pfarrer in Kreis Soest, Christoph Fleischer:
Weiter mit Inhalt. Warum die einzige anständige Briefausgabe der Droste eine einzige Besprechung auf Amazon.de hat (5 Sterne) und Der Schwarm von Frank Schätzing deren 1321, weiß ich auch nicht, aber es beschleunigt die Meinungsbildung ungemein. Es rezensiert der evangelische Pfarrer in Kreis Soest, Christoph Fleischer:
Gerade diese vollständige Briefausgabe ist von unschätzbarem Wert. Wie eine große Muschel enthält sie eine Perle, das Gedicht „Unruhe“, das die fast noch jugendliche Annette von Droste-Hülshoff ihrem Förderer Prof. Sprickmann nach Breslau hinterher schreibt. Das sollen zwei Zitate zeigen:
Rastlos treibts mich um im engen Leben
Und zu Boden drücken Raum und Zeit
Freyheit heißt der Seele banges Streben
Und im Busen tönts Unendlichkeit.
Während dieser Vers noch vom Freiheitsgedanken z. B. eines Friedrich Schiller kündet, zeigt der nächste eine anfänglich feministische Spur:
Fesseln will man uns am eignen Heerde!
Unsre Sehnsucht nennt man Wahn und Traum
Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde
Hat doch für die ganze Schöpfung Raum.
Die Briefe sind eine gute Ergänzung zur Lektüre einer Biografie wie z. B. die der Barbara Beuys. In kurzen biografischen Skizzen werden die Briefempfänger im Anhang porträtiert, und alle in den Texten genannten Personen werden im Stichwortverzeichnis aufgeführt.
 Überhaupt ist der Vorteil der Briefausgabe — die ich, lieber Medimops, jeden Moment erwarte — in ihrer Eigenschaft als historisch-kritische, dass sie die Briefe in der originalen Rechtschreibung mit allen -th- und -ey- belässt. Der erwähnte Professor Anton Matthias Sprickmann war offenbar zwischen 1812 und 1819 der Droste literarischer Mentor und bringt mich auf einen zu Recht verborgenen Schatz des Internets: ihre Kurzbiographie, möglicherweise für Schulzwecke. Der umgebende Brief an Sprickmann stammt von Ende Februar 1816, das Gedicht mithin vom Januar oder Februar 1816, als die „fast jugendliche“ Droste 19 war. In der Gesamtausgabe steht es deshalb unter den Gedichten aus dem Nachlass. Briefauszug:
Überhaupt ist der Vorteil der Briefausgabe — die ich, lieber Medimops, jeden Moment erwarte — in ihrer Eigenschaft als historisch-kritische, dass sie die Briefe in der originalen Rechtschreibung mit allen -th- und -ey- belässt. Der erwähnte Professor Anton Matthias Sprickmann war offenbar zwischen 1812 und 1819 der Droste literarischer Mentor und bringt mich auf einen zu Recht verborgenen Schatz des Internets: ihre Kurzbiographie, möglicherweise für Schulzwecke. Der umgebende Brief an Sprickmann stammt von Ende Februar 1816, das Gedicht mithin vom Januar oder Februar 1816, als die „fast jugendliche“ Droste 19 war. In der Gesamtausgabe steht es deshalb unter den Gedichten aus dem Nachlass. Briefauszug:
Ich schicke ihnen hierbey ein kleines Gedicht was ich vor einigen Wochen verfertigt habe, nehmen sie es gütig auf, es mahlt den damaligen, und eigentlich auch den jetzigen Zustand meiner Seele vollkommen, obschon diese fast fieberhafte Unruhe, mit Verschwinden meines Uebelbefindens einigermaßen sich gelegt hat.
Erst am 2. April 1817, nach über einem Jahr, kommt Sprickmann darauf zurück:
Ueber die „Unruhe„, mit der Sie mir ein so theures Geschenk gemacht haben, kann ich Ihnen in diesem Augenblick nichts sagen, weil sie schon unter meinen übrigen Heiligthümern tief im Koffer liegt. Aber das kann ich Ihnen doch von dem Eindruck, den auch dieses Gedicht von Ihnen auf mich gemacht hat, sagen, daß ich es dem Besten, was ich von Ihnen kenne, gleich setze.
Kurz: Eigentlich scheint es zu gut, um im Nachlass zu schlummern — so wie sich überhaupt nach einer Woche mit der Gesamtausgabe abzeichnet, dass die Sachen von der Droste, die zu ihren Lebzeiten kein Publikum erlebt haben, so wie eben der Nachlass und die Briefe, viel mehr Spaß machen als ihre Veröffentlichungen. Darum jetzt endlich weiter mit dem richtigen Inhalt: dem Gedicht selbst, mit aller fieberhaften Unruhe, Sehnsucht und Seemannsromantik, in seinem freiheitskämpferischen und protofeministischen Kontext und original belassener Rechtschreibung.
——— Annette von Droste-Hülshoff:
Unruhe
Januar/Februar 1816,
Erstdruck in Hermann Hüffer: Annette von Droste-Hülshoff, in: Deutsche Rundschau 7,
Februar/März 1881, Band 26, Heft 5 und 6, Seite 208–228, 421–446,
Gedichttext Seite 217:
Laß uns hier ein wenig ruhn am Strande
FOIBOS Stralen spielen auf dem Meere
Siehst du dort der Wimpel weiße Heere
Reisge Schiffe ziehn zum fernen LandeAch! wie ists erhebend sich zu freuen
An des Ozeans Unendlichkeit
Kein Gedanke mehr an Maaß und Räume
Ist, ein Ziel, gesteckt für unsre Träume
Ihn zu wähnen dürfen wir nicht scheuen
Unermeßlich wie die Ewigkeit.Wer hat ergründet
Des Meeres Gränzen
Wie fern die schäumende Woge es treibt
Wer seine Tiefe
Wenn muthlos kehret
Des Senkbley’s Schwere
Im wilden Meere
Des Ankers Rettung vergeblich bleibt.Möchtest du nicht mit den wagenden Seglern
Kreisen auf dem unendlichen Plan?
O! ich möchte wie ein Vogel fliehen
Mit den hellen Wimpeln möcht ich ziehen
Weit, o weit wo noch kein Fußtritt schallte
Keines Menschen Stimme wiederhallte
Noch kein Schiff durchschnitt die flüchtge BahnUnd noch weiter, endlos ewig neu
Mich durch fremde Schöpfungen, voll Lust
Hinzuschwingen fessellos und frey,
O! das pocht das glüht in meiner Brust
Rastlos treibts mich um im engen Leben
Und zu Boden drücken Raum und Zeit
Freyheit heißt der Seele banges Streben
Und im Busen tönts Unendlichkeit!Stille, stille, mein thörichtes Herz
Willst du denn ewig vergebens dich sehnen?
Mit der Unmöglichkeit hadernde Trähnen
Ewig vergießen in fruchtlosem Schmerz?So manche Lust kann ja die Erde geben
So liebe Freuden jeder Augenblick
Dort stille Herz dein glühendheißes Beben
Es giebt des Holden ja so viel im Leben
So süße Lust und, ach! so seltnes Glück!Denn selten nur genießt der Mensch die Freuden
Die ihn umblühn sie schwinden ungefühlt
Sey ruhig, Herz, und lerne dich bescheiden
Giebt FOIBOS heller Strahl dir keine Freuden
Der freundlich schimmernd auf der Welle spielt?Laß uns heim vom feuchten Strande kehren
Hier zu weilen, Freund, es thut nicht wohl,
Meine Träume drücken schwer mich nieder
Aus der Ferne klingts wie Heymathslieder
Und die alte Unruh‘ kehret wieder
Laß uns heim vom feuchten Strande kehren
Wandrer auf den Wogen, fahret wohl!Fesseln will man uns am eignen Heerde!
Unsre Sehnsucht nennt man Wahn und Traum
Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde
Hat doch für die ganze Schöpfung Raum!
Natürlich freu ich mich auf Meersburg und meine Eltern, jedenfalls werde ich ihnen nichts anderes erzählen. Damit bin ich noch am besten beraten, weil mein Vater nächsthin 80 wird. „Ach! wie ists erhebend sich zu freuen“.
Bilder, weil die Droste-Portraits schon recht verbreitet sind:
Sea-Worthy!, technicolor pin-up print, 1955;
Exclusively Yours, technicolor pin-up print of Diane Webber, 1950s;
John Bradshaw Crandell: Water Nymphs, 1938;
Duane Bryers: Hilda,
Paul Albert Laurens: Catching Waves,
via Grapefruit Moon Gallery.
Denkst du denn nicht an den Loup Garou?
Update zu Des Maies Wonneschlingen:
Die Droste überrascht. War in der Schule Die Judenbuche noch so freudlos wie jeder andere Schulstoff, der mit Juden zu tun hatte, auch, trifft man sie in der Frühzeit des Bloggens mit ihren gesammelten Briefen als Gewinnerin des Grimme-Online-Preises wieder, und den notorisch galligen, weil fränkischen Zeichnern Greser & Lenz war sie im jungen Jahrtausend ein so anzügliches, dabei glaubwürdiges Nacktbild wert, dass man es hierher, liebe minderjährige Stoffsammler für den Deutschunterricht, gar nicht verlinken kann.
Und plötzlich gestaltet sie ihre Dezimen fünf- statt, wie im pyrenäischen Spanien üblich, vierhebig und wechselt sie so formsicher mit refrainhaltigen Stanzen ab, dass man darauf tanzen und sie in die Nähe der verwegensten Spielereien von Brentano rücken möchte. Aber vorerst nur ganz kurz.
Die Pyrenäen waren im Biedermeier ungefähr eine Saison lang ein beliebtes Thema fiktiver Gestaltung. In der äußeren Wirklichkeit kann „Bagneres“ für das französische Bagnères-de-Bigorre oder Bagnères-de-Luchon stehen; eine nennenswert bewallfahrene „Heilige Frau von Embrun“ konnte ich in der Embruner Kathedrale nicht feststellen, aber Notre-Dame-du-Réal stammt aus dem 12. Jahrhundert und sieht sehr romanisch-gotisch ehrwürdig und vor allem einladend aus – genau nebenan gibt’s bestimmt ein Glas eisgekühlten Pastis mit genug Leitungswasser, damit es einen heißen Urlaubsnachmittag lang reicht –, wenn es einen schon wegen einer übermütigen Gruselballade mal in die Pyrenäen verschlüge.
——— Annette von Droste-Hülshoff:
III. Der Loup Garou
für: Kölnische Zeitung, 1844/45,
in: Letzte Gaben. Nachgelassene Blätter. Hrsg. v. Levin Schücking. Hannover, 1860,
Volksglauben in den Pyrenäen:
Brüderchen schläft, ihr Kinder, still!
Setzt euch ordentlich her zum Feuer!
Hört ihr der Eule wüst Geschrill?
Hu! im Walde ist’s nicht geheuer.
Frommen Kindern geschieht kein Leid,
Drückt nur immer die Lippen zu,
Denn das böse, das lacht und schreit,
Holt die Eul‘ und der Loup Garou.Wißt ihr, dort, wo das Naß vom Schiefer träuft
Und übern Weg ’ne andre Straße läuft,
Das nennt man Kreuzweg, und da geht er um,
Bald so, bald so, doch immer falsch und stumm,
Und immer schielend; vor dem Auge steht
Das Weiße ihm, so hat er es verdreht;
Dran ist er kenntlich und am Kettenschleifen,
So trabt er, trabt, darf keinem Frommen nahn;
Die schlimmen Leute nur, die darf er greifen
Mit seinem langen, langen, langen Zahn.Schiebt das Reisig der Flamme ein,
Puh! wie die Funken knistern und stäuben!
Pierrot, was soll das Wackeln sein?
Mußt ein Weilchen du ruhig bleiben,
Gleich wird die Zeit dir Jahre lang!
Laß doch den armen Hund in Ruh‘!
Immer sind deine Händ‘ im Gang,
Denkst du denn nicht an den Loup Garou?Vom reichen Kaufmann hab‘ ich euch erzählt,
Der seine dürft’gen Schuldner so gequält,
Und kam mit sieben Säcken von Bagneres,
Vier von Juwelen, drei von Golde schwer;
Wie er aus Geiz den schlimmen Führer nahm,
Und ihm das Unthier auf den Nacken kam.
Am Halse sah man noch der Kralle Spuren,
Die sieben Säcke hat es weggezuckt,
Und seine Börse auch, und seine Uhren,
Die hat es all zerbissen und verschluckt.Schließt die Thür, es brummt im Wald!
Als die Sonne sich heut verkrochen,
Lag das Wetter am Riff geballt,
Und nun hört man’s sieden und kochen.
Ruhig, ruhig, du kleines Ding!
Hörst du? — drunten im Stalle — hu!
Hörst du? Hörst du’s? kling, klang, kling,
Schüttelt die Kette der Loup Garou.Doch von dem Trunkenbolde wißt ihr nicht,
Dem in der kalten Weihnacht am Gesicht
Das Thier gefressen, daß am heil’gen Tag
Er wund und scheußlich überm Schneee lag;
Zog von der Schenke aus, in jeder Hand
‚Ne Flasche, die man auch noch beide fand;
Doch wo die Wangen sonst, da waren Knochen,
Und wo die Augen, blut’ge Höhlen nur;
Und wo der Schädel hier und da zerbrochen,
Da sah man deutlich auch der Zähne Spur.
Wie am Giebel es knarrt und kracht!
Caton, schau auf die Bühne droben
— Aber nimm mir die Lamp‘ in Acht —,
Ob vor die Luke der Riegel geschoben.
Pierrot, Schlingel! das rutscht herab
Von der Bank, ohne Strümpf‘ und Schuh‘!
Willst du bleiben! tapp, tipp, tapp,
Geht auf dem Söller der Loup Garou.Und meine Mutter hat mir oft gesagt
Von einem tauben Manne, hochbetagt,
Fast hundertjährig, dem es noch geschehn
Als Kind, daß er das Scheuel hat gesehn,
Recht wie ’nen Hund, nur weiß wie Schnee und ganz
Verkehrt die Augen, eingeklemmt den Schwanz,
Und spannenlang die Zunge aus dem Schlunde,
So mit der Kette weg an Waldes Bord,
Dann wieder sah er ihn im Tobelgrunde,
Und wieder sah er hin — da war er fort.Hab‘ ich es nicht gedacht? es schneit!
Ho, wie fliegen die Flocken am Fenster!
Heilige Frau von Embrun! wer heut
Draußen wandelt, braucht keine Gespenster;
Irrlicht ist ihm die Nebelsäul‘,
Führt ihn schwankend dem Abgrund zu,
Sturmes Flügel die Todteneul‘,
Und der Tobel sein Loup Garou.
Bilder: Dr. Urbanus Rhegius: Wie man die falschen Propheten erkennen/ ja greiffen mag/
Ein Predig zu Mynden jnn Westphalen gethan/ durch D. Urbanum Rhegium:
Die Hirten sind zu Narren worden/ und fragen nichts nach Gott/ Darumb können sie auch nichts rechts leren/ sondern zerstrewet die Herd, Wittenberg. M. D. XXXIX
Wittenberg 1539;
Leonie Swann: Garou: Ein Schaf-Thriller, Goldmann, München 2010.
Zeichenstifter
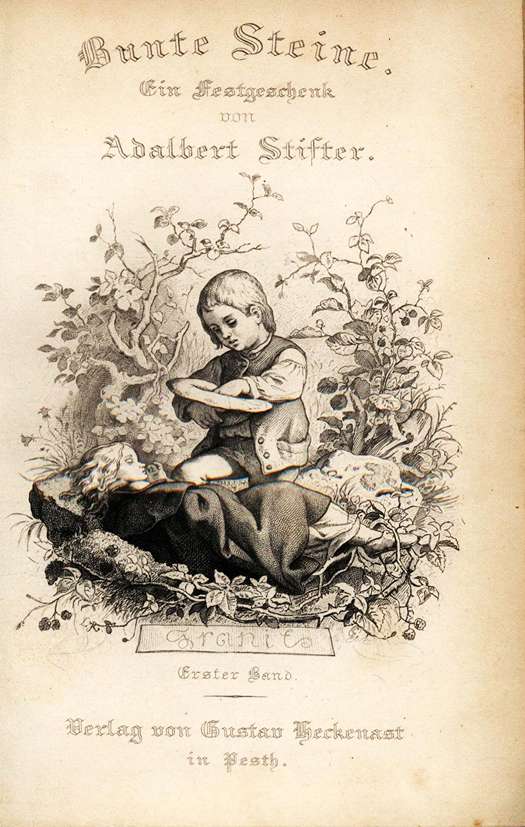 Die dtv-Ausgabe von Adalbert Stifters Sämtlichen Erzählungen nach den Erstdrucken, ein veritabler Backstein von Taschenbuch mit 1648 Seiten, orientiert sich an der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe im Kohlhammer Verlag und belässt die originale Rechtschreibung. Beides tun Taschenbücher selten. Bei dtv war es eine Unternehmung zu Ehren von Stifters 200. Geburtstag 2005.
Die dtv-Ausgabe von Adalbert Stifters Sämtlichen Erzählungen nach den Erstdrucken, ein veritabler Backstein von Taschenbuch mit 1648 Seiten, orientiert sich an der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe im Kohlhammer Verlag und belässt die originale Rechtschreibung. Beides tun Taschenbücher selten. Bei dtv war es eine Unternehmung zu Ehren von Stifters 200. Geburtstag 2005.
Und es zeigt schlagend, wie sich Kommasetzung auf den Tonfall auswirken kann. Die bekannte Passage über das Prinzip des sanften Gesetzes aus der Vorrede zu Bunte Steine wäre mit korrekter Zeichensetzung nach den aktuellen Regeln nicht halb so frappierend.
——— Adalbert Stifter:
Bunte Steine
Ein Festgeschenk. Verlag von Gustav Heckenast, Pest. Leipzig, bei Georg Wigand, 1853.
Vorrede, Im Herbste 1852:
Das Wehen der Luft das Rieseln des Wassers das Wachsen der Getreide das Wogen des Meeres das Grünen der Erde das Glänzen des Himmels das Schimmern der Gestirne halte ich für groß: das prächtig einherziehende Gewitter, den Bliz, welcher Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer als obige Erscheinungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen viel höherer Geseze sind. Sie kommen auf einzelnen Stellen vor, und sind die Ergebnisse einseitiger Ursachen. Die Kraft, welche die Milch im Töpfchen der armen Frau empor schwellen und übergehen macht, ist es auch, die die Lava in dem feuerspeienden Berge empor treibt, und auf den Flächen der Berge hinab gleiten läßt.
 Bunte Steine
Bunte Steine
- Vorrede
- Granit
- Kalkstein
- Turmalin
- Bergkristall
- Katzensilber
- Bergmilch
Illustrationen: Ludwig Richter: Frontspize zur Erstausgabe Adalbert Stifter: Bunte Steine, 1853.
Band 1: Motiv aus Granit; Band 2: Motiv aus Bergkristall.
Gar kein Advent mehr: Das Männlein in der Gans
Update zum Spielmann:
Zu Weihnachten 1813 schenkte der 25-jährige Friedrich Rückert seiner kleinsten, damals dreijährigen Schwester Maria eine Sammlung aus fünf selbstgemachten Gedichten, die er innerhalb einer einzigen Nacht ausgearbeitet und niedergeschrieben hatte. Maria starb 1835, als sie ihrerseits 25 war.
——— Friedrich Rückert:
Fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein.
Zum Christtag 1813:
5 von 5
Das Männlein in der Gans
Das Männlein ging spazieren einmal
Auf dem Dach, ei seht doch!
Das Männlein ist hurtig, das Dach ist schmal,
Gib acht, es fällt noch.
Eh‘ sich’s versieht, fällt’s vom Dach herunter
Und bricht den Hals nicht, das ist ein Wunder.Unter dem Dach steht ein Wasserzuber,
Hineinfällt’s nicht schlecht;
Da wird es naß über und über,
Ei, das geschieht ihm recht.
Da kommt die Gans gelaufen,
Die wird’s Männlein saufen.Die Gans hat’s Männlein ’nuntergeschluckt,
Sie hat einen guten Magen;
Aber das Männlein hat sie doch gedruckt,
Das wollt‘ ich sagen.
Da schreit die Gans ganz jämmerlich;
Das ist der Köchin ärgerlich.Die Köchin wetzt das Messer,
Sonst schneidt’s ja nicht:
Die Gans schreit so, es ist nicht besser,
Als daß man sie sticht;
Wir wollen sie nehmen und schlachten
Zum Braten auf Weihnachten.Sie rupft die Gans und nimmt sie aus,
Und brät sie,
Aber das Männlein darf nicht ‚raus,
Versteht sich.
Die Gans wird eben gebraten;
Was kann’s dem Männlein schaden?Weihnachten kommt die Gans auf den Tisch
Im Pfännlein;
Der Vater tut sie ‚raus und zerschneid’t sie frisch.
Und das Männlein?
Wie die Gans ist zerschnitten,
Kriecht’s Männlein aus der Mitten.Da springt der Vater vom Tisch auf,
Da wird der Stuhl leer;
Da setzt das Männlein sich drauf,
Und macht sich über die Gans her.
Es sagt: „Du hast mich gefressen,
Jetzt will ich dafür dich essen.“Da ißt das Männlein gewaltig drauf los,
Als wären’s seiner sieben;
Da essen wir alle dem Männlein zum Trotz,
Da ist nichts übriggeblieben
Von der ganzen Gans, als ein Tätzlein,
Das kriegen dort hinten die Kätzlein.Nichts kriegt die Maus,
Das Märlein ist aus.Das Kind fragt:
Was ist denn das?
Antwort:
Ein Weihnachts-Spaß;
Aufs Neujahr lernst
Du, was?
Den Ernst.

Bilder: Ludwig Richter: Die Mutter am Christabend, Holzstich. In mehreren Ausgaben nachgedruckt, hier nach: Johann Peter Hebel: Werke. Hrsg. von Paul Alverdes. München: Carl Hanser o.J., S. 364
via Goethezeitportal;
Daniel Chodowiecki: Hausliches Fest am Weihnachts Abend, 1799.
4. Advent: Der Spielmann
Update zum Bäumlein, das spazieren ging:
Zu Weihnachten 1813 schenkte der 25-jährige Friedrich Rückert seiner kleinsten, damals dreijährigen Schwester Maria eine Sammlung aus fünf selbstgemachten Gedichten, die er innerhalb einer einzigen Nacht ausgearbeitet und niedergeschrieben hatte. Maria starb 1835, als sie ihrerseits 25 war.
——— Friedrich Rückert:
Fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein.
Zum Christtag 1813:
4 von 5
Der Spielmann
Der Spielmann stimmt seine Geigen
Und spricht zu ihr:
„Du sollst dein Kunststück zeigen,
Komm, geh mit mir!“
Der Spielmann geht mit ihr vor ein Schloß;
’s ist Nacht, der Spielmann fiedelt drauf los.
Der Spielmann sagt: „’s ist nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Vor dem Schloß ist ein Garten,
Mit Bäum‘ und Pflanzen;
Die können die Zeit nicht erwarten,
Zu tanzen.
Der Spielmann fiedelt vor dem Schloß,
Die Bäume tanzen alle drauf los.
Der Spielmann spricht: „’s ist nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Im Garten ist ein Weiher,
Darin sind Fisch‘;
Die hören auch das Geleier
Und tanzen frisch.
Der Spielmann fiedelt vor dem Schloß,
Die Bäum‘ und die Fische tanzen drauf los.
Der Spielmann spricht: „’s ist noch nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Im Schlosse drin sind Mäuse,
Der Spielmann spielt auf;
Die Mäuse hören leise,
Sie wachen auf.
Der Spielmann fiedelt vor dem Schloß;
Bäume, Fisch‘ und Mäuse tanzen drauf los.
Der Spielmann spricht: „’s ist noch nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Im Schloß sind Tisch‘ und Bänke,
Die werden wach,
Sie kommen aus dem Gelenke
Und tanzen nach.
Der Spielmann fiedelt vor dem Schloß;
Bäume, Fische, Mäuse, Bänke tanzen drauf los.
Der Spielmann spricht: „’s ist noch nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Sind denn keine Menschen vorhanden?
Der Spielmann spricht:
„Ich spiele mich schier zu schanden,
Sie hören nicht.“
Bäume, Fische, Mäuse, Bänke tanzen drauf los;
Wollen die Menschen nicht aus dem Schloß?
Der Spielmann spricht: „’s ist noch nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Da wird das Schloß auf einmal ganz
Lebendig,
Es stellt sich auf die Spitz‘ und tanzt
Unbändig.
Der Spielmann spielt, es tanzt das Schloß,
Die Menschen schlafen noch immer drauf los.
Der Spielmann spricht: „’s ist noch nicht genug,
Ich muß fiedeln noch einen Zug.“Da tanzt das Schloß bis in Stücken es geht
Mit Krachen;
Nun hören es endlich die Menschen im Bett
Und erwachen;
Sie hören den Spielmann spielen vorm Schloß
Und tanzen nun auch mit dem andern Troß.
Der Spielmann spricht: „Nun ist es genug;
Doch will ich fiedeln noch einen Zug.“Das Kind fragt:
Warum denn noch einen?
Antwort:
Wegen des Männleins in der Gans.
Das Kind fragt:
Muß das auch an den Tanz?
Das Kind fragt:
Wird gleich erscheinen.
Bild: Frances Benjamin Johnston: Miss Apperson Playing Banjo, 1895;
Spielleute: Hilary Hahn auf Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice für Violine allein: Der Erkönig, op. 26;
Rhonda Vincent & the Rage auf Ervin T. Rouse: Orange Blossom Special, 1938/2011.
3. Advent: Vom Bäumlein, das spazieren ging
Update zum Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt:
Zu Weihnachten 1813 schenkte der 25-jährige Friedrich Rückert seiner kleinsten, damals dreijährigen Schwester Maria eine Sammlung aus fünf selbstgemachten Gedichten, die er innerhalb einer einzigen Nacht ausgearbeitet und niedergeschrieben hatte. Maria starb 1835, als sie ihrerseits 25 war.
——— Friedrich Rückert:
Fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein.
Zum Christtag 1813:
3 von 5
Vom Bäumlein, das spazieren ging
Das Bäumlein stand im Wald
In gutem Aufenthalt;
Da standen Busch und Strauch
Und andre Bäumlein auch;
Die standen dicht und enge,
Es war ein recht’s Gedränge;
Das Bäumlein mußt‘ sich bücken
Und sich zusammen drücken;
Da hat das Bäumlein gedacht
Und mit sich ausgemacht:
„Hier mag ich nicht mehr stehn,
Ich will wo anders gehn
Und mir ein Örtlein suchen,
Wo weder Birk‘ noch Buchen,
Wo weder Tann‘ noch Eichen
Und gar nichts desgleichen;
Da will ich allein mich pflanzen
Und tanzen.“Das Bäumlein das geht nun fort
Und kommt an einen Ort,
In ein Wiesenland,
Wo nie ein Bäumlein stand,
Da hat sich’s hingepflanzt
Und hat getanzt.Dem Bäumlein hat’s vor allen
An dem Örtlein gefallen;
Ein gar schöner Bronnen
Kam zum Bäumlein geronnen;
War’s dem Bäumlein zu heiß,
Kühlt’s Brünnlein seinen Schweiß.
Schönes Sonnenlicht
War ihm auch zugericht‘;
War’s dem Bäumlein zu kalt,
Wärmt‘ die Sonn‘ es bald.
Auch ein guter Wind
War ihm hold gesinnt,
Der half mit seinem Blasen
Ihm tanzen auf dem Rasen.Das Bäumlein tanzt‘ und sprang
Den ganzen Sommer lang;
Bis es vor lauter Tanz
Hat verloren den Kranz.
Der Kranz mit den Blättlein allen
Ist ihm vom Kopf gefallen;
Die Blättlein lagen umher,
Das Bäumlein hat keines mehr;
Die einen lagen im Bronnen,
Die andern in der Sonnen,
Die andern Blättlein geschwind
Flogen umher im Wind.Wie’s Herbst nun war und kalt,
Da fror’s das Bäumlein bald;
Es rief zum Brunnen nieder:
„Gib meine Blättlein mir wieder,
Damit ich doch ein Kleid
Habe zur Winterszeit.“
Das Brünnlein sprach: „Ich kann eben
Die Blättlein dir nicht geben;
Ich habe sie alle getrunken,
Sie sind in mich versunken.“Da kehrte von dem Bronnen
Das Bäumlein sich zur Sonnen:
„Gib mir die Blättlein wieder,
Es friert mich an die Glieder.“
Die Sonne sprach: „Nun eben
Kann ich sie dir nicht geben;
Die Blättlein sind längst verbrannt
In meiner heißen Hand.“Da sprach das Bäumlein geschwind
Zum Wind:
„Gib mir die Blättlein wieder,
Sonst fall‘ ich tot darnieder.“
Der Wind sprach: „Ich eben
Kann dir die Blättlein nicht geben;
Ich hab‘ sie über die Hügel
Geweht mit meinem Flügel.“
Da sprach das Bäumlein ganz still:
„Nun weiß ich, was ich will;
Da haußen ist mir’s zu kalt,
Ich geh‘ in meinen Wald,
Da will ich unter die Hecken
Und Bäume mich verstecken.“Da macht sich’s Bäumlein auf
Und kommt im vollen Lauf
Zum Wald zurück gelaufen,
Und will sich stell’n in den Haufen.
’s fragt gleich beim ersten Baum:
„Hast du keinen Raum?“
Der sagt: „Ich habe keinen!“
Da fragt das Bäumlein noch einen,
Der hat wieder keinen;
Da fragt das Bäumlein noch einen:
Es fragt von Baum zu Baum,
Aber kein einz’ger hat Raum.
Sie standen schon im Sommer
Eng in ihrer Kammer;
Jetzt im kalten Winter
Stehn sie noch enger dahinter.
Dem Bäumchen kann nichts frommen,
Es kann nicht unterkommen.Da geht es traurig weiter
Und friert, denn es hat keine Kleider;
Da kommt mittlerweile
Ein Mann mit einem Beile,
Der reibt die Hände sehr,
Tut auch, als ob’s ihn frör‘.
Da denkt das Bäumlein wacker:
„Das ist ein Holzhacker;
Der kann den besten Trost
Mir geben für meinen Frost.“Das Bäumlein spricht schnell
Zum Holzhacker: „Gesell,
Dich friert’s so sehr wie mich
Und mich so sehr wie dich.
Vielleicht kannst du mir
Helfen und ich dir.
Komm, hau‘ mich um
Und trag‘ mich in deine Stub’n,
Schür‘ ein Feuer an,
Und leg‘ mich dran;
So wärmst du mich
Und ich dich.“Das deucht dem Holzhacker nicht schlecht,
Er nimmt sein Beil zurecht;
Haut’s Bäumlein in die Wurzel,
Umfällt’s mit Gepurzel;
Nun hackt er’s klein und kraus
Und trägt das Holz nach Haus
Und legt von Zeit zu Zeit
In den Ofen ein Scheit.Das größte Scheit von allen
Ist uns fürs Haus gefallen;
Das soll die Magd uns holen,
So legen wir’s auf die Kohlen;
Das soll die ganze Wochen
Uns unsre Suppen kochen.
Oder willst du lieber Brei?Das Kind sagt:
Das ist mir einerlei.

Bilder: Daniel Chodowiecki in Olga Amberger (Hg.):
Zeitgenossen Chodowieckis. Lose Blätter schweizerischer Buchkunst; Rhein-Verlag, Basel 1921, Seite 45;
Btrachtn.
2. Advent: Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt
Update zum Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen:
Zu Weihnachten 1813 schenkte der 25-jährige Friedrich Rückert seiner kleinsten, damals dreijährigen Schwester Maria eine Sammlung aus fünf selbstgemachten Gedichten, die er innerhalb einer einzigen Nacht ausgearbeitet und niedergeschrieben hatte. Maria starb 1835, als sie ihrerseits 25 war.

——— Friedrich Rückert:
Fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein.
Zum Christtag 1813:
2 von 5
Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt
Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald
In gutem und schlechtem Wetter;
Das hat von unten bis oben
Nur Nadeln gehabt statt Blätter;
Die Nadeln, die haben gestochen,
Das Bäumlein, das hat gesprochen:„Alle meine Kameraden
Haben schöne Blätter an,
Und ich habe nur Nadeln,
Niemand rührt mich an;
Dürft‘ ich wünschen, wie ich wollt‘,
Wünscht‘ ich mir Blätter von lauter Gold.“Wie’s Nacht ist, schläft das Bäumlein ein,
Und früh ist’s aufgewacht;
Da hatt‘ es goldene Blätter fein,
Das war eine Pracht!
Das Bäumlein spricht: „Nun bin ich stolz;
Goldene Blätter hat kein Baum im Holz.“Aber wie es Abend ward,
Ging der Jude durch den Wald
Mit großem Sack und großem Bart,
Der sieht die goldnen Blätter bald;
Er steckt sie ein, geht eilends fort
Und läßt das leere Bäumlein dort.Das Bäumlein spricht mit Grämen:
„Die goldnen Blättlein dauern mich,
Ich muß vor den andern mich schämen,
Sie tragen so schönes Laub an sich.
Dürft‘ ich mir wünschen noch etwas,
So wünscht‘ ich mir Blätter von hellem Glas.“Da schlief das Bäumlein wieder ein,
Und früh ist’s wieder aufgewacht;
Da hatt‘ es glasene Blätter fein,
Das war eine Pracht!
Das Bäumchen sprach: „Nun bin ich froh;
Kein Baum im Walde glitzert so.“Da kam ein großer Wirbelwind
Mit einem argen Wetter,
Der fährt durch alle Bäume geschwind
Und kommt an die gläsernen Blätter;
Da lagen die Blätter von Glase
Zerbrochen in dem Grase.Das Bäumlein spricht mit Trauern:
„Mein Glas liegt in dem Staub;
Die anderen Bäume dauern
Mit ihrem grünen Laub.
Wenn ich mir noch was wünschen soll,
Wünsch‘ ich mir grüne Blätter wohl.“Da schlief das Bäumlein wieder ein,
Und wieder früh ist’s aufgewacht;
Da hatt‘ es grüne Blätter fein.
Das Bäumlein lacht
Und spricht: „Nun hab‘ ich doch Blätter auch,
Daß ich mich nicht zu schämen brauch‘.“Da kommt mit vollem Euter
Die alte Geiß gesprungen;
Sie sucht sich Gras und Kräuter
Für ihre Jungen;
Sie sieht das Laub und fragt nicht viel,
Sie frißt es ab mit Stumpf und Stiel.Da war das Bäumchen wieder leer,
Es sprach nun zu sich selber:
„Ich begehre nun keine Blätter mehr,
Weder grüner, noch roter, noch gelber!
Hätt‘ ich nur meine Nadeln,
Ich wollte sie nicht tadeln.“Und traurig schlief das Bäumlein ein,
Und traurig ist es aufgewacht;
Da besieht es sich im Sonnenschein
Und lacht und lacht!
Alle Bäume lachen’s aus;
Das Bäumlein macht sich aber nichts daraus.Warum hat’s Bäumlein denn gelacht,
Und warum denn seine Kameraden?
Es hat bekommen in der Nacht
Wieder alle seine Nadeln,
Daß jedermann es sehen kann.
Geh‘ ’naus, sieh’s selbst, doch rühr’s nicht an!Das Kind fragt:
Warum denn nicht?
Antwort:
Weil’s sticht.

Bilder von Baum und Busch: Marlene Depetri:
Autorretrato, 20. September 2014; Ser, 18. Oktober 2014.
1. Advent: Vom Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen
Weiteres Update zum unterschätzten Rückert:
Des Frühlings beklommnes Herz (diesmal richtig):

Zu Weihnachten 1813 schenkte der 25-jährige Friedrich Rückert seiner kleinsten, damals dreijährigen Schwester Maria eine Sammlung aus fünf selbstgemachten Gedichten, die er innerhalb einer einzigen Nacht ausgearbeitet und niedergeschrieben haben wollte, und die heute ein sträflich vernachlässiger Kinderklassiker ist.
Maria starb 1835, als sie ihrerseits 25 war — so wie Rückerts Leben allgemein viel zu voll von Todesfällen viel zu junger Menschen war. Über Mariechen ist wenig überliefert, aber durch diese Sammlung war ihr zerbrechliches Leben nicht ganz umsonst.
Rückerts Familie stammte aus Oberfranken, der Tonfall und manche Wort- und Satzbildungen sind daher unverkennbar fränkisch und eignen sich unschlagbar zum Vorlesen.
Der Erstveröffentlichung in Marias Todesjahr stellte Rückert einen Epitaph als Motto voran:
——— Friedrich Rückert:
Fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein.
Zum Christtag 1813:
Einst hab‘ ich Märchen zum Einschläfern dir gesungen,
Nun haben dich in Schlaf gesungen Engelzungen.
Um zu erwachen dort, bist du hier eingeschlafen;
Fahr wohl! im Sturme sind wir noch, du bist im Hafen.Johannis 1835.
1 von 5
Vom Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen
Denk an! das Büblein ist einmal
Spazieren gangen im Wiesental;
Da wurd’s müd‘ gar sehr,
Und sagt: Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme,
Und mich mitnähme!
Da ist das Bächlein geflossen kommen,
Und hat’s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich auf’s Bächlein gesetzt,
Und hat gesagt: So gefällt mir’s jetzt.Aber was meinst du? das Bächlein war kalt,
Das hat das Büblein gespürt gar bald;
Es hat’s gefroren gar sehr,
Es sagt: Ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme,
Und mich mitnähme!
Da ist das Schifflein geschwommen kommen.
Und hat’s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich auf’s Schifflein gesetzt,
Und hat gesagt: Da gefällt mir’s jetzt.Aber siehst du? das Schifflein war schmal,
Das Büblein denkt: Da fall‘ ich einmal;
Da fürcht‘ es sich gar sehr,
Und sagt: Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme,
Und mich mitnähme!
Da ist die Schnecke gekrochen gekommen,
Und hat’s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich in’s Schneckenhäuslein gesetzt,
Und hat gesagt: da gefällt mir’s jetzt.Aber denk! die Schnecke war kein Gaul,
Sie war im Kriechen gar zu faul;
Dem Büblein ging’s langsam zu sehr;
Es sagt: Ich mag nicht mehr;
Wenn nur was käme,
Und mich mitnähme!
Da ist der Reiter geritten gekommen,
Der hat’s Büblein mitgenommen;
Das Büblein hat sich hinten auf’s Pferd gesetzt,
Und hat gesagt: So gefällt mir’s jetzt.Aber gib Acht! das ging wie der Wind,
Es ging dem Büblein gar zu geschwind;
Es hopst d’rauf hin und her,
Und schreit: ich kann nicht mehr;
Wenn nur was käme,
Und mich mitnähme!
Da ist ein Baum ihm in’s Haar gekommen,
Und hat das Büblein mitgenommen;
Er hat’s gehängt an einen Ast gar hoch,
Dort hängt das Büblein und zappelt noch.Das Kind fragt:
Ist denn das Büblein gestorben?
Antwort:
Nein! es zappelt ja noch!
Morgen gehn wir ’naus und tun’s runter.

Bilder: Frohes Weihnachtsfest! Adressseite: „Meisteraufnahmen“. Echte Photographie.
„Ross“ Verlag, Berlin SW 68. Beschrieben, aber nicht gelaufen. Handschriftlich: 1934;
Bezirkslehrerverein München: Das Kaulbach-Güll Bilderbuch. Auswahl aus Friedrich Gülls Kinderheimat mit Bildern von Hermann Kaulbach, Verlag der Jugendblätter (Carl Schnell) München 1910, Titelillustration: Weihnachten;
Gesegnete Weihnacht. Adressseite: Amag [Albrecht & Meister AG, Berlin-Reinickendorf], gelaufen.
Poststempel unleserlich, ca. 1934,
alle via Goethezeitportal.
Barfußwochen 06: Laß mich die Aschengruttel sein in deinem Märchen
Update zu Wer fühlt den Krampf der Freuden und der Schmerzen nicht:
Sollten Geistliche Literatur schaffen? Da haben wir wieder was zum Diskutieren. (Ist aber langweilig, reden wir lieber von schönen Mädchen.)
 Wenn es so hinausläuft wie beim biedermeierlichen Dorfgeistlichen Eduard Mörike, sollten sie es wenigstens dürfen: Die Geistlichen der Christenheit haben in ihrer Geschichte weit Schlimmeres angerichtet als schlechte Gedichte – wobei man Mörike heute noch nicht rundum schlecht finden muss. Vielmehr würde ohne seine lyrischen Experimente und liebevollen Landgeschichten einiges fehlen.
Wenn es so hinausläuft wie beim biedermeierlichen Dorfgeistlichen Eduard Mörike, sollten sie es wenigstens dürfen: Die Geistlichen der Christenheit haben in ihrer Geschichte weit Schlimmeres angerichtet als schlechte Gedichte – wobei man Mörike heute noch nicht rundum schlecht finden muss. Vielmehr würde ohne seine lyrischen Experimente und liebevollen Landgeschichten einiges fehlen.
Landgeschichten bedeutet auch, dass Mörike am meisten auf dem Gebiet der Idylle geleistet hat – einer Gattung, die sich eher inhaltlich denn formal definiert; Idyllen sind Gedichte in allen Formen und Farben oder Prosa von der Anekdote bis zum Roman. Gerade Mörikes Kunstmärchen in Novellenstärke vom Stuttgarter Hutzelmännlein besticht durch seinen naiv altschwäbischen Tonfall nicht nur in den Dialogen, sondern auch der Erzählinstanz. Salopper und verständlicher gesagt, klingt das ganze Ding durchgehend so hinreißend danach, als ob ein gut gelaunter schwäbischer Opa hochdeutsch zu reden versucht, dass man aus dem Grinsen gar nicht rauskommt.
Idylle bedeutet wiederum, dass Mörike dem zu Recht vergessenen Salomon Geßner nicht nur geographisch sehr viel näher steht als, sagen wir, Quentin Tarantino. Und trotzdem: Gucken wir mal genauer.
Im Stuttgarter Hutzelmännlein bringt Mörike eine eigenständige Binnenerzählung unter, wie in Novellen recht gängig: Die Historie von der schönen Lau. Die besagte Lau ist eine Nixe nicht im großen weiten Weltmeer, sondern damit es schwäbisch bleibt, im Blautopf, mithin ein regionales Zugeständnis an die seit Fouqué grassierenden Geschichten von Melusinen, Sirenen und sonstigen Wasserweibern, unter denen heute noch am bekanntesten die Kleine Seejungfrau von Andersen in ihren zahllosen Bearbeitungen ist: eine ausführliche Parabel über die erotische Bedeutsamkeit menschlicher Beine und Füße.
 Andersens Seejungfrau war deshalb eine genuine Nixe, um in einem Fischschwanz zu enden und sich ihr Paar Füße erst mühsam zu verdienen und damit vor Liebesschmerz unglücklich zu werden. Alle anderen weiblichen Wasserwesen, allen voran die besonders sexuell konnotierten Sirenen, sind nicht mit einer hässlichen, obendrein für Liebespraktiken unter Säugetieren ungeeigneten Fischhälfte inkommodiert, sondern selbstverständlich mit den wunderschönsten Beinen gesegnet.
Andersens Seejungfrau war deshalb eine genuine Nixe, um in einem Fischschwanz zu enden und sich ihr Paar Füße erst mühsam zu verdienen und damit vor Liebesschmerz unglücklich zu werden. Alle anderen weiblichen Wasserwesen, allen voran die besonders sexuell konnotierten Sirenen, sind nicht mit einer hässlichen, obendrein für Liebespraktiken unter Säugetieren ungeeigneten Fischhälfte inkommodiert, sondern selbstverständlich mit den wunderschönsten Beinen gesegnet.
Die schöne Lau zum Beispiel ist allgemein ein „Wasserweib“, weil sich eine „Undine“ im Blautopf wohl ausnähme wie Paris Hilton in Glonn (nicht der beste Vergleich, weil Paris Hilton sich die gottverliehene Schönheit ihrer Zehen wahrscheinlich von klein auf mit zu engen Stöckelschuhen ruiniert hat). Was macht Mörike daraus? Er nutzt die Anatomie seiner leuchtend hübschen Hauptfigur, um sie von ihren Füßen aus zu charakterisieren.
Und genau das trägt uns jetzt doch zu Tarantino. Zum 20. Jahrestag ist mal wieder Gelegenheit, sein Pulp Fiction anzuschauen. Und diesmal achten wir besonders darauf, wie Uma Thurman eingeführt wird: barfuß von unten, ihre Wohnung herrschaftlich beschreitend, in einer aufwändigen Kamerafahrt über den Teppich. Nicht die einzige Stelle, an der er seinen Filmfrauen offensiv die Füße abfilmt, aber eine, an der das alte Spielkind Tarantino nicht allzu offensichtlich seine eigenen erotischen Vorlieben verfolgt – weil Umas Thurmans Füße nämlich vorher in der Handlung Gegenstand eines sprichwörtlich gewordenen Dialogs über Fußmassagen waren und außerdem gebraucht werden, um ihre Person in einer Art Schlangentanz und ihr kleopatrisches Wesen – sie trägt sogar die Frisur der Kleopatra im Asterix – zu verdeutlichen, was in Schuhen nicht halb so gut funktioniert hätte.
Mörikes schöne Lau ist als unbezweifelte, konkurrenzlose Königin des Blautopfs weniger darauf angewiesen, ständig ihr Herrschertum hervorzukehren, bewegt sich ohnedies an Land unter lauter niederem, obrigkeitstreuem Bauern- und Handwerkervolk und darf deswegen ungleich entspannter dargestellt werden. Zugleich idyllisch und tarantinisch anhand ihrer Füße:
——— Eduard Mörike:
Die Historie von der schönen Lau
in: Das Stuttgarter Hutzelmännlein, 1853:
Zuunterst auf dem Grund saß ehmals eine Wasserfrau mit langen fließenden Haaren. Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen, natürlichen Weibs, dies eine ausgenommen, daß sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zärter als ein Blatt vom Mohn.
[…]
Die Schwiegermutter hatte ihr zum Dienst und Zeitvertreib etliche Kammerzofen und Mägde mitgegeben, so muntere und kluge Mädchen, als je auf Entenfüßen gingen (denn was von dem gemeinen Stamm der Wasserweiber ist, hat rechte Entenfüße); die zogen sie, pur für die Langeweile, sechsmal des Tages anders an – denn außerhalb dem Wasser ging sie in köstlichen Gewändern, doch barfuß –, erzählten ihr alte Geschichten und Mären, machten Musik, tanzten und scherzten vor ihr.
[…]
Einsmals an einem Nachmittag im Sommer, da eben keine Gäste kamen, der Sohn mit den Knechten und Mägden hinaus in das Heu gefahren war, Frau Betha mit der Ältesten im Keller Wein abließ, die Lau im Brunnen aber Kurzweil halben dem Geschäft zusah und nun die Frauen noch ein wenig mit ihr plauderten, da fing die Wirtin an: „Mögt Ihr Euch denn einmal in meinem Haus und Hof umsehn? Die Jutta könnte Euch etwas von Kleidern geben; ihr seid von einer Größe.“
„Ja“, sagte sie, „ich wollte lange gern die Wohnungen der Menschen sehn, was alles sie darin gewerben, spinnen, weben, angleichen auch wie Eure Töchter Hochzeit machen und ihre kleinen Kinder in der Wiege schwenken.“ Da lief die Tochter fröhlich mit Eile hinauf, ein rein Leintuch zu holen, bracht‘ es und half ihr aus dem Kasten steigen, das tat sie sonder Mühe und lachenden Mundes. Flugs schlug ihr die Dirne das Tuch um den Leib und führte sie bei ihrer Hand eine schmale Stiege hinauf in der hintersten Ecke des Kellers, da man durch eine Falltür oben gleich in der Töchter Kammer gelangt. Allda ließ sie sich trocken machen und saß auf einem Stuhl, indem ihr Jutta die Füße abrieb. Wie diese ihr nun an die Sohle kam, fuhr sie zurück und kicherte. „War’s nicht gelacht?“ frug sie selber sogleich. – „Was anders?“ rief das Mädchen und jauchzte: „gebenedeiet sei uns der Tag! ein erstes Mal wär‘ es geglückt!“ – Die Wirtin hörte in der Küche das Gelächter und die Freude, kam herein, begierig, wie es zugegangen, doch als sie die Ursach‘ vernommen – du armer Tropf, so dachte sie, das wird ja schwerlich gelten! – ließ sich indes nichts merken, und Jutte nahm etliche Stücke heraus aus dem Schrank, das Beste was sie hatte, die Hausfreundin zu kleiden. „Seht“, sagte die Mutter: „sie will wohl aus Euch eine Susann Preisnestel machen.“ – „Nein“, rief die Lau in ihrer Fröhlichkeit, „laß mich die Aschengruttel sein in deinem Märchen!“ – nahm einen schlechten runden Faltenrock und eine Jacke; nicht Schuh noch Strümpfe litt sie an den Füßen, auch hingen ihre Haare ungezöpft bis auf die Knöchel nieder. So strich sie durch das Haus von unten bis zu oberst, durch Küche, Stuben und Gemächer. Sie verwunderte sich des gemeinsten Gerätes und seines Gebrauchs, besah den rein gefegten Schenktisch und darüber in langen Reihen die zinnenen Kannen und Gläser, alle gleich gestürzt, mit hängendem Deckel, dazu den kupfernen Schwenkkessel samt der Bürste und mitten in der Stube an der Decke der Weber Zunftgeschmuck, mit Seidenband und Silberdraht geziert, in dem Kästlein von Glas.
[…]
Indem der Spinnerinnen eine diesen Schwank erzählte, tat die Wirtin einen schlauen Blick zur Lau hinüber, welche lächelte; denn freilich wußte sie am besten, wie es gegangen war mit dieser Messerei; doch sagten beide nichts. Dem Leser aber soll es unverhalten sein.
Die schöne Lau lag jenen Nachmittag auf dem Sand in der Tiefe, und, ihr zu Füßen, eine Kammerjungfer, Aleila, welche ihr die liebste war, beschnitte ihr in guter Ruh die Zehen mit einer goldenen Schere, wie von Zeit zu Zeit geschah.
Bilder: Alberich Matthews‘ Lieblingsmodel Hannah:
Quickstep, 25. Mai 2008; Call Her Moonchild, 4. April 2008; Sightseeing, 14. September 2008;
Moritz von Schwind: Entwürfe zur Historie von der schönen Lau, ca. 1868 via Goethezeitportal.
Schwarze Butter (eine reizende, ursprüngliche Landkonfitüre, um altes Zeug aus dem Kühlschrank aufzubrauchen)
Update zu Erdäpfelgulasch und Zwetschgenzeit:
Die Romane von Jane Austen gelten seit jeher als Mädchenbücher, erstens weil es so schön übersichtlich wenige sind, zweitens weil in ihnen die Romantik in der Liebe unter zwei gegenschlechtlichen Menschen keinen Raum hat, sondern drittens auf möglichst direktem — das heißt: doch ziemlich verschlungenem — Wege in eine wirtschaftlich angemessene Ehe zu münden hat, dem viertens kein normaler Mensch folgen kann.
Obwohl das gerade das Luzideste war, was ich je über Jane Austen geschrieben und vielleicht sogar gelesen habe, sind keine Kochbücher darunter. Für die Kochrezepte des Hauses Austen muss man in den Briefwechsel hinabsteigen. Eins von bestechender Einfachheit und verlockendem Nutzen findet sich in der Abteilung Frühstück und Fünf-Uhr-Tee. Keine Angst davor, nur weil es Schwarze Butter heißt:
——— Jane Austen to Cassandra about Black Butter, Castlesquare, December 27th, 1808:
The last hour, spent in yawning and shivering in a wide circle round the fire, was dull enough, but the tray had admirable success. The widgeon and the preserved ginger were as delicious as one could wish. But as to our black butter, do not decoy anybody to Southampton by such a lure, for it is all gone. The first pot was opened when Frank and Mary were here, and proved not at all what it ought to be; it was neither solid nor entirely sweet, and on seeing it Eliza remembered that Miss Austen had said she did not think it had been boiled enough. It was made, you know, when we were absent. Such being the event of the first pot, I would not save the second, and we therefore ate it in unpretending privacy; and though not what it ought to be, part of it was very good.
Das wie niemand anders zu dergleichen berufene Jane Austen Centre erschließt uns späten Anhängern des Merry Old England eine praktikable Version:
Take 4 pounds of full ripe apples, and peel and core them. Meanwhile put into a pan 2 pints of sweet cider, and boil until it reduces by half. Put the apples, chopped small, to the cider. Cook slowly stirring frequently, until the fruit is tender, as you can crush beneath the back of a spoon. Then work the apple through a sieve, and return to the pan adding 1lb beaten (granulated) sugar and spices as following, 1 teaspoon clove well ground, 2 teaspoons cinnamon well ground, 1 saltspoon allspice well ground. Cook over low fire for about ¾ hour, stirring until mixture thickens and turns a rich brown. Pour the butter into into small clean jars, and cover with clarified butter when cold. Seal and keep for three months before using. By this time the butter will have turned almost black, and have a most delicious flavour.
In Deutschland sind solche Delikatessen der berüchtigten englischen Küche im Jane Austen Kochbuch erreichbar — selbst bei immerhin Reclam ohne Bindestriche, aber so eingehend recherchiert, kundig kommentiert, stimmungsvoll illustriert und vom Übersetzer Lutz Walther nicht einfach übertragen, sondern für einen gedeihlichen deutschen Hausgebrauch eingerichtet, dass man eigentlich gar nichts mehr nachkochen muss — was gerade bei der Ernährungsweise des kronenglischen Inselvolks ein Vorteil sein kann.
Das gute Stück, mein persönliches Kochbuch des Jahres, ist seit März 2013 schon im Juli ins Moderne Antiquariat abgewandert — wahrscheinlich weil sie sich bei Hugendubel nicht einigen konnten, ob sie es unter Klassiker oder Kochbücher einsortieren sollten: Von sowas hängt Kultur ab. Die Schwarze Butter findet sich unter Speisekammerkünste:
——— Maggie Black, Deirdre Le Faye, übs. Lutz Walther:
Schwarze Butter
(Für Kinder; eine preiswerte Konfitüre),
in: Das Jane Austen Kochbuch, Reclam, März 2013:
Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, oder was immer zur Hand ist, pflücken: auf je zwei Pfund Früchte nimmt man ein Pfund Zucker und koche es so lange, bis es um einiges reduziert ist.
Für die Zubereitung heute lässt sich eine Mischung aus allen oder einigen der oben genannten Obstsorten verwenden. Für je 1 kg Früchte benötigt man 450 g weißen Zucker. Alle Früchte entstielen und abspülen, schimmelige Stellen entfernen. Alles vermischen und schonend in einem Topf erhitzen, bis Flüssigkeit austritt. Den Zucker einrühren, bis er sich auflöst, und dick einkochen lassen. In kleine heiße Gläser füllen und wie Konfitüre verschließen.
Dies ist eine reizende, ursprüngliche Landkonfitüre, fast unverändert, dafür von der Weisheit Mary Norwaks geprägt. Sie sagt, sie sei ideal, um altes Zeug aus dem Kühlschrank aufzubrauchen.
Es läuft darauf hinaus, Kühlschrankreste unter fleißigem Zuckern zu Matsch zu kochen. Die Übersetzung lässt den Cider, die Gewürze, den Überzug aus Butterschmalz und die drei Monate Ruhezeit weg, einen Versuch ist alles wert — vor allem der Zimt; den Cider kriegt man wieder nur im abgelegensten Fachhandel. Das wird seinen kulinarischen Grund haben, verfehlt aber den Sinn der Resteverwertung.
Besonders Austenesque wären Stachelbeeren, die hat Miss Austen sehr gemocht und im eigenen Garten gezogen. Ich empfehle nicht mehr als drei Obstsorten: Vierfruchtmarmelade ist die minderwertige Schlonze aus dem „Super“markt; außerdem hat, wer mehr als drei Sorten vergammeln lässt, ein grundsätzlicheres Problem als ein Pfund angedätschtes Obst.
Ein Vorteil des Rezeptes ist, dass es normalen Zucker vorsieht, keinen Gelierzucker, den man hinterher für nichts anderes hernehmen kann und seinerseits rumstauben hat. Ein Vorteil der Übertragung ist, dass man in Deutschland, wenn man weiß, wo, Brot auftreiben kann. Viel Brot! Dicke Scheiben! Nicht die durschscheinbaren Läppchen, die Brotschneidemaschinen hergeben! Aber echter englischer Tee dazu ist okay. Kommt ja aus Indien.
Die Wölfin meint: „Da hat das ganze Häubchen-DVD-Geglotze endlich mal einen Wert.“
Bilder: Maggie Black, Deirdre Le Faye, übs. Lutz Walther: Das Jane Austen Kochbuch, Reclam 2013;
Rebecca Alejandra für Ars Antigua: The Apple Picker, 15. September 2011.
Blumenstück 002: Die Zueignung der Zuneigung
Beiträge zur deutsch-italienischen Freundschaft.
Friedrich Overbeck: Italia und Germania, 1828.
Öl auf Leinwand, 94,4 cm × 104,7 cm, Neue Pinakothek München.
Emlan: Italia und Germania, 4. März 2013.
Paraphrase of a painting with the same name by Johann Friedrich Overbeck.
Bitstrips Photos: Katrina and Federica Start Reading Goethe’s Faust, 2. Oktober 2013,
ruoli principali Federica Ligarò e Katrina Clara Liszt.
Zur Orientierung: Italien ist links, Deutschland ist rechts. In allen drei Bildern. Muss ja nichts heißen.
Doing a Grillparzer
Update zu (Ändere die Welt.) Sie braucht es:
——— Franz Grillparzer in: Sinngedichte und Epigramme, 1872 (Österreich):
Nichts, was nur ächt historisch ist,
Gieng je in diesem Land verloren,
Drum herrschen zwei Parteien itzt:
Die Wichte und die Thoren.


Zwei Parteien: Izzy Guttuso: Botany, 1. Januar 2010;
Ash Hershberger: The Butterfly Keeper’s Daughter, 17. Juni 2012.
Noch zwei: Nick Cave & Shane MacGowan: Wonderful World, 1992.
Auf einen Satz der Wölfin
 Liebling, wenn ich dich nicht hätt,
Liebling, wenn ich dich nicht hätt,
wär doppelt so viel Platz im Bett,
denn dein ganzes Körperfett
mach ich durch die Länge wett.
~~~\~~~~~~~/~~~
„Wenn du eine geschallert brauchst, kannst du gern in Prosa mit mir reden.“
„Die jungen Frauen haben das Flirten verlernt.“
„Die alten Deppen auch.“
~~~\~~~~~~~/~~~
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn:
M: Carl Reinecke; T: Österreich, vor 1900;
Kunstpostkarte Franziska Schenkel: Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn, Kunstverlag Georg Michel, Nürnberg.
















